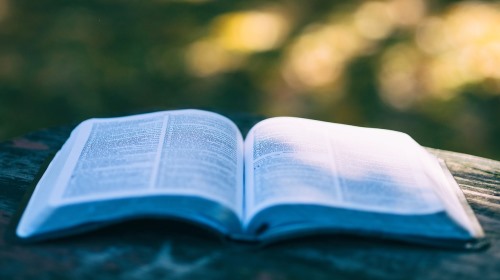Die Verleihung der Bayerischen Literaturstipendien 2012
Es war kein rosiges Bild, das Kunstminister Dr. Wolfgang Heubisch vom Schriftstellerdasein in heutigen Zeiten zeichnete. Der ausdifferenzierte Markt und die stressige Medienmaschinerie kosteten Autorinnen und Autoren Zeit und Geld, sodass die fürs Schreiben so wichtige Muße zu kurz komme; nicht zu vergessen die Debatten ums Urheberrecht, die bei vielen für Unsicherheit sorgen. „Nötiger denn je“ sei deshalb die staatliche Unterstützung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, auch und gerade derjenigen, die als etablierte Schreiber für viele Förderungen nicht mehr in Betracht kommen, da sie nicht mehr als „Nachwuchshoffnung“ gehandelt werden können. Auch dem entgegen tritt das Literaturstipendium des Freistaats, das keine Altersgrenze kennt. Am Dienstag wurden sechs davon vergeben; die Ausgezeichneten lasen aus ihren Werken und erzählten im anschließenden Werkstattgespräch über deren Hintergründe.
*
Dass jedes Erzählen im Unbekannten gründet, brachte Lena Gorelik gleich zu Beginn mit einem Auszug aus ihrem Roman-Projekt mit dem Arbeitstitel Die Listensammlerin auf den Punkt. Die Figur des Onkel Grischa, einer von zwei Protagonisten, wird als beliebter, unaufhörlicher und großer Erzähler vorgestellt, um sogleich darauf hinzuweisen, dass er nichts davon selbst erlebt habe, da er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren sei, von dem die meisten und aufregendsten seiner Geschichten handeln. Ihr eigenes großes Thema, die Familie, erklärte Lena Gorelik beinahe schon ‚genetisch‘: Familie werde man nicht los; selbst wenn man sie nicht in allen Teilen kenne, habe sie dennoch Einfluss auf das Ich. Dieser unbekannten Familie auf die Spur gerät die zweite und titelgebende Hauptfigur des Romans aufgrund einer merkwürdigen Identität: Eines Tages entdeckt sie eine Schachtel mit ähnlich seltsamen Listen, wie sie eigentlich nur sie selbst anfertigt.
Steffen Kopetzky hat das Schreiben ins Offene ganz anders beim Wort genommen. Sein Manuskript ist eine Kontrafaktur, eine Was-wäre-wenn-Geschichte: Great Game erzählt von einem anderen Ausgang des Ersten Weltkriegs, der vielwahrscheinlicher ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Tatsächlich wollte das Deutsche Reich damals mit Afghanistan anbandeln, um gemeinsam das British Empire in die Flucht zu schlagen. In der Wirklichkeit scheiterte dieser Plan – bei Kopetzky gelingt er. Obwohl der Ton ornamental, ja, ‚orientalisierend‘ klingt, kann man die Hinweise auf die heutige Weltlage freilich nicht übersehen. „Am großen Spiel hat sich bis heute nichts geändert“, erklärte Kopetzky und benannte auch seine Faszination dafür, dass Geschichte im Grunde eine Ansammlung von mehr oder weniger zufälligen Ereignissen darstelle und also in jedem Moment auch einen ganz anderen Weg hätte nehmen können.
Sowohl von einer familiären als auch von einer wissenschaftlichen Leerstelle handelt wiederum Heiko Wolz´ Jugendbuch Polywasser. Eine dominante Mutter erkrankt an einem Hirntumor und wird zum Pflegefall, während der Vater einem wissenschaftlichen Phantom hinterherjagt, nämlich jenem titelgebenden „Polywasser“ (das keine Erfindung von Wolz, sondern eine Realität der 1970er Jahre ist). Dass die Geschichte gar nicht so traurig ist, wie man nun meinen könnte, verdankt man Wolz´ Sinn für Komik und fürs Absurde – den der Autor allerdings gerade mit dem Ernst der Lage erklärte: Seine Komik fuße auf dem Tragischen, nur der düstere Hintergrund ermöglich die lichte Pointe.
Die zweite Runde der PreisträgerInnen eröffnete Nina Jäckle mit einer Lesung aus ihrem Manuskript, das den Arbeitstitel Hilda und Sophie trägt. Wie bei Gorelik, so treffen auch bei Jäckle zwei Menschen aus verschiedenen Generationen aufeinander. Bei Jäckle ist das allerdings nicht das Ziel der Handlung, sondern deren Ausgangspunkt: Eine alte Dame namens Hilda und ein junges Mädchen namens Sophie öffnen gleichzeitig ihre Wohnungstür, weil sie meinen, ein Geräusch gehört zu haben – und stehen also plötzlich voreinander. Wo genau das hinführt, weiß Nina Jäckle nach eigener Aussage selbst noch nicht, zentrales Thema sei die der „freundliche Vereinnahmung eines Menschen“. Auch wenn ihre Romane ihr selbst nach Fertigstellung oft sehr planvoll vorkämen, das seien sie ganz und gar nicht, gab sie im Gespräch freimütig zu. In Hilda und Sophie wird das sogar literarisch reflektiert, denn Jäckle erzählt in einer, wie sie das nennt, „unterstellten“ Perspektive. „Mag sein …“ heißt es wiederholt in dem Text. Das Erzählte wird nicht behauptet, sondern angenommen.
Ähnlich und doch ganz anders Petra Morsbach, die sich vielleicht keine fremderes Ich für ihren neuen Roman Dichterliebe hätte aussuchen können. Darin erzählt ein in der ehemaligen DDR etablierter Lyriker von seiner Gegenwart im Nachwende-Deutschland, von seinem Leben in der „neuen Welt“, die weder von Lyrik noch von DDR allzu viel wissen will. Eben diese Fremdheit – sowohl des Dichters als auch der Autorin selbst – ist es, die Morsbach interessiert: Die Realität sei schließlich viel spannender als jedes ideale oder idealisierte Dasein, in dem alles glatt laufe.
Ganz ausdrücklich vom Hineinschreiben ins Unbekannte sprach Christine Pitzke, deren Manuskript Im Hotel der kleinen Bilder von einem Portier erzählt, der in den Koffern seiner Gäste nach dem „Morgigen“ lauscht. Die Vergangenheit, so Pitzke, sei schließlich immer schon festgeschrieben, während in der Zukunft, die im Nu zur Gegenwart werde, noch alles offen stünde.
Das Morgige, an diesem Abend konnte man es tatsächlich hören – in den Lesungen von Lena Gorelik, Steffen Kopetzky, Heiko Wolz, Nina Jäckle, Petra Morsbach und Christine Pitzke. Ob diese Texte so oder ein wenig anders das Licht der Buchwelt erblicken werden, lässt sich jetzt freilich noch nicht sagen. Aber daran, dass all diese Gestalten und Geschichten erscheinen werden, besteht kein Zweifel.
Die Verleihung der Bayerischen Literaturstipendien 2012
Es war kein rosiges Bild, das Kunstminister Dr. Wolfgang Heubisch vom Schriftstellerdasein in heutigen Zeiten zeichnete. Der ausdifferenzierte Markt und die stressige Medienmaschinerie kosteten Autorinnen und Autoren Zeit und Geld, sodass die fürs Schreiben so wichtige Muße zu kurz komme; nicht zu vergessen die Debatten ums Urheberrecht, die bei vielen für Unsicherheit sorgen. „Nötiger denn je“ sei deshalb die staatliche Unterstützung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, auch und gerade derjenigen, die als etablierte Schreiber für viele Förderungen nicht mehr in Betracht kommen, da sie nicht mehr als „Nachwuchshoffnung“ gehandelt werden können. Auch dem entgegen tritt das Literaturstipendium des Freistaats, das keine Altersgrenze kennt. Am Dienstag wurden sechs davon vergeben; die Ausgezeichneten lasen aus ihren Werken und erzählten im anschließenden Werkstattgespräch über deren Hintergründe.
*
Dass jedes Erzählen im Unbekannten gründet, brachte Lena Gorelik gleich zu Beginn mit einem Auszug aus ihrem Roman-Projekt mit dem Arbeitstitel Die Listensammlerin auf den Punkt. Die Figur des Onkel Grischa, einer von zwei Protagonisten, wird als beliebter, unaufhörlicher und großer Erzähler vorgestellt, um sogleich darauf hinzuweisen, dass er nichts davon selbst erlebt habe, da er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren sei, von dem die meisten und aufregendsten seiner Geschichten handeln. Ihr eigenes großes Thema, die Familie, erklärte Lena Gorelik beinahe schon ‚genetisch‘: Familie werde man nicht los; selbst wenn man sie nicht in allen Teilen kenne, habe sie dennoch Einfluss auf das Ich. Dieser unbekannten Familie auf die Spur gerät die zweite und titelgebende Hauptfigur des Romans aufgrund einer merkwürdigen Identität: Eines Tages entdeckt sie eine Schachtel mit ähnlich seltsamen Listen, wie sie eigentlich nur sie selbst anfertigt.
Steffen Kopetzky hat das Schreiben ins Offene ganz anders beim Wort genommen. Sein Manuskript ist eine Kontrafaktur, eine Was-wäre-wenn-Geschichte: Great Game erzählt von einem anderen Ausgang des Ersten Weltkriegs, der vielwahrscheinlicher ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Tatsächlich wollte das Deutsche Reich damals mit Afghanistan anbandeln, um gemeinsam das British Empire in die Flucht zu schlagen. In der Wirklichkeit scheiterte dieser Plan – bei Kopetzky gelingt er. Obwohl der Ton ornamental, ja, ‚orientalisierend‘ klingt, kann man die Hinweise auf die heutige Weltlage freilich nicht übersehen. „Am großen Spiel hat sich bis heute nichts geändert“, erklärte Kopetzky und benannte auch seine Faszination dafür, dass Geschichte im Grunde eine Ansammlung von mehr oder weniger zufälligen Ereignissen darstelle und also in jedem Moment auch einen ganz anderen Weg hätte nehmen können.
Sowohl von einer familiären als auch von einer wissenschaftlichen Leerstelle handelt wiederum Heiko Wolz´ Jugendbuch Polywasser. Eine dominante Mutter erkrankt an einem Hirntumor und wird zum Pflegefall, während der Vater einem wissenschaftlichen Phantom hinterherjagt, nämlich jenem titelgebenden „Polywasser“ (das keine Erfindung von Wolz, sondern eine Realität der 1970er Jahre ist). Dass die Geschichte gar nicht so traurig ist, wie man nun meinen könnte, verdankt man Wolz´ Sinn für Komik und fürs Absurde – den der Autor allerdings gerade mit dem Ernst der Lage erklärte: Seine Komik fuße auf dem Tragischen, nur der düstere Hintergrund ermöglich die lichte Pointe.
Die zweite Runde der PreisträgerInnen eröffnete Nina Jäckle mit einer Lesung aus ihrem Manuskript, das den Arbeitstitel Hilda und Sophie trägt. Wie bei Gorelik, so treffen auch bei Jäckle zwei Menschen aus verschiedenen Generationen aufeinander. Bei Jäckle ist das allerdings nicht das Ziel der Handlung, sondern deren Ausgangspunkt: Eine alte Dame namens Hilda und ein junges Mädchen namens Sophie öffnen gleichzeitig ihre Wohnungstür, weil sie meinen, ein Geräusch gehört zu haben – und stehen also plötzlich voreinander. Wo genau das hinführt, weiß Nina Jäckle nach eigener Aussage selbst noch nicht, zentrales Thema sei die der „freundliche Vereinnahmung eines Menschen“. Auch wenn ihre Romane ihr selbst nach Fertigstellung oft sehr planvoll vorkämen, das seien sie ganz und gar nicht, gab sie im Gespräch freimütig zu. In Hilda und Sophie wird das sogar literarisch reflektiert, denn Jäckle erzählt in einer, wie sie das nennt, „unterstellten“ Perspektive. „Mag sein …“ heißt es wiederholt in dem Text. Das Erzählte wird nicht behauptet, sondern angenommen.
Ähnlich und doch ganz anders Petra Morsbach, die sich vielleicht keine fremderes Ich für ihren neuen Roman Dichterliebe hätte aussuchen können. Darin erzählt ein in der ehemaligen DDR etablierter Lyriker von seiner Gegenwart im Nachwende-Deutschland, von seinem Leben in der „neuen Welt“, die weder von Lyrik noch von DDR allzu viel wissen will. Eben diese Fremdheit – sowohl des Dichters als auch der Autorin selbst – ist es, die Morsbach interessiert: Die Realität sei schließlich viel spannender als jedes ideale oder idealisierte Dasein, in dem alles glatt laufe.
Ganz ausdrücklich vom Hineinschreiben ins Unbekannte sprach Christine Pitzke, deren Manuskript Im Hotel der kleinen Bilder von einem Portier erzählt, der in den Koffern seiner Gäste nach dem „Morgigen“ lauscht. Die Vergangenheit, so Pitzke, sei schließlich immer schon festgeschrieben, während in der Zukunft, die im Nu zur Gegenwart werde, noch alles offen stünde.
Das Morgige, an diesem Abend konnte man es tatsächlich hören – in den Lesungen von Lena Gorelik, Steffen Kopetzky, Heiko Wolz, Nina Jäckle, Petra Morsbach und Christine Pitzke. Ob diese Texte so oder ein wenig anders das Licht der Buchwelt erblicken werden, lässt sich jetzt freilich noch nicht sagen. Aber daran, dass all diese Gestalten und Geschichten erscheinen werden, besteht kein Zweifel.