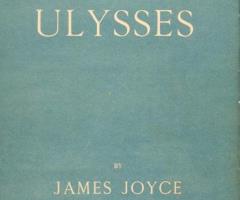Joyce-Kenner Harald Beck über die Realitätsbesessenheit eines Romans, der auch in München hätte spielen können
Mit seinem Roman Ulysses erlangte der irische Schriftsteller James Joyce (1882-1941), der heute vor 134 Jahren geboren wurde, Weltruhm. Sein Werk steckt voller Bezüge zur zeitgenössischen Lebenswelt des Autors, dem Dublin der Jahrhundertwende, das der Leser auf seiner Odyssee durchstreift. Mit einer Münchner lokalpatriotischen Variante erklärt der Joyce-Herausgeber und Übersetzer Harald Beck, warum es auch heute noch lohnt, Joyce (wieder) zu lesen.
Wenn Leopold Bloom – und sollten Sie nicht wissen, ![]() wer das ist, dann können Sie jetzt noch diskret die Flucht ergreifen – also, wenn Leopold Bloom in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 1904 nach circa 16-stündiger Stadtodyssee wieder sein Wohnzimmer betritt, stößt er sich unversehens den Kopf an. (Vergessen Sie nicht, dass Privathaushalte 1904 kein elektrisches Licht hatten! Bloom marschiert mit der Kerze durchs nächtliche Haus.) Seine Frau, die am Nachmittag zum ersten Mal von ihrem Liebhaber besucht wurde, hat die Möbel im Wohnzimmer umgestellt. Mit seinen Lesern springt Joyce noch wesentlich robuster um: Uns stößt er auf jeder Seite vor den Kopf unserer Lesegewohnheiten, Denkfaulheiten, unreflektierten Erwartungen, Rezeptionsklischees. Die Irrfahrten des Dubliner Odysseus sind auch die des Lesers: Schiffbrüche und der Verlust von Gefährten drohen allemal.
wer das ist, dann können Sie jetzt noch diskret die Flucht ergreifen – also, wenn Leopold Bloom in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 1904 nach circa 16-stündiger Stadtodyssee wieder sein Wohnzimmer betritt, stößt er sich unversehens den Kopf an. (Vergessen Sie nicht, dass Privathaushalte 1904 kein elektrisches Licht hatten! Bloom marschiert mit der Kerze durchs nächtliche Haus.) Seine Frau, die am Nachmittag zum ersten Mal von ihrem Liebhaber besucht wurde, hat die Möbel im Wohnzimmer umgestellt. Mit seinen Lesern springt Joyce noch wesentlich robuster um: Uns stößt er auf jeder Seite vor den Kopf unserer Lesegewohnheiten, Denkfaulheiten, unreflektierten Erwartungen, Rezeptionsklischees. Die Irrfahrten des Dubliner Odysseus sind auch die des Lesers: Schiffbrüche und der Verlust von Gefährten drohen allemal.
Bevor wir gemeinsam mit den Hauptfiguren des Romans durch Dublin und seine nähere Umgebung irren, möchte ich Ihnen Reiz und Schwierigkeiten der Ulysses-Lektüre mit einer lokalpatriotischen Variante nahebringen. Lassen wir Ulysses kurzfristig in München spielen. Das hatte damals immerhin schon 600.000 Einwohner (Dublin gerade 400.000). Donnerstag, den 16. Juni 1904 ersetzen wir durch Freitag, den 10. November 1916. In dieser isarmetropolitischen Odyssee ist für die Abendstunden eine Episode vorgesehen, in der unser Held, Leopold Blume, er akquiriert Annoncen für die München-Augsburger Zeitung und seine Frau heißt Anna, eine geborene Schwitters, hier unter unseren nostalgischen Nasen am Salvatorplatz vorbei schlendert. Es ist kühl und neblig, der Steckrüben-Winter dräut, Poldis Gedanken sind bei Anzeigen und Meldungen vom Tage: Weihnachten im Feld, starb den Heldentod, Hoflieferant Paul Samberger, Nussbaumstraße 16, künstliche Arme und Beine in vorzüglicher Ausführung, Interessenten steht der illustrierte Katalog A41/B42 zur Verfügung, Hygiene der Ehe, ob der Herr Impressario, mit dem Anna den Nachmittag verbracht hat, sich was drum schert? Die üblichen Druckfehler: Togal rztlich Aeempfohlen gegen Kopfschmerzen. In diesem Augenblick begegnet er einem elegant gekleideten Paar um die Dreißig, das von der Prannerstraße kommend durch die Promenadenstraße jetzt eher zügigen Schritts der Briennerstraße zustrebt.
Der Herr auffallend groß und schlank. Der Tonfall fällt ihm auf, Preißn san des und im Licht einer Straßenlaterne sieht er ungläubig, dass der ganze Mund der Dame lückenlos goldüberkront schimmert. Schiach schaugt des aus. Neugierig folgt er dem Paar, bis es nach kurzem orientierenden Zögern im Luitpoldblock, Eingang Briennerstraße 8 verschwindet. Spät nachts wird sich der Herr in einem ironischen Rollentausch der erwartungsfrohen Dame gegenüber auf eine Migräne berufen und das Nichtehepaar sinkt in seine getrennten Betten in einfachen Schlafzimmern mit Bad, zwei Sesseln, großem Spiegel, Perserteppich, Goldrandspiegel, Frisierkommode und elektrischem Licht.
Welchen Heimvorteil hätte der zeitgenössische Münchner in unserem Fall gegenüber einem – sagen wir irischen Leser des Jahres 2016? Er würde die Prannerstraße und zwei ortsunkundige, elegant gekleidete Preißn ziemlich sicher mit dem Bayerischen Hof verbinden, die Briennerstraße 8 zumindest mit dem Café Luitpold, vielleicht sogar mit der Kunsthandlung Goltz. Aber auch er hätte nicht gewusst, es sei denn, er hätte Rilke geheißen, dass an diesem Abend dort in einem kalten, schlecht beleuchteten Saal im 1. Stock, in dem expressionistische Bilder hingen, der Fontane-Preisträger Dr. Franz Kafka ein paar Gedichte von Max Brod und seine „schmutzige kleine Geschichte“ In der Strafkolonie vortrug. Felice Bauer war extra aus Berlin angereist zu diesem ersten Treffen, nachdem sie im Juli in Marienbad miteinander vertraut geworden waren. Auch in manch anderer Hinsicht eine gespenstische Episode. Es soll unter den Zuhörerinnen zu Ohnmachten gekommen sein.
Bucherstausgabe des Ulysses von 1922 (l.); Leopold Bloom, Zeichnung von James Joyce (r.).
Ulysses enthält viele hunderte solcher Momente, in denen Fiktion und Faktisch-Historisches eine kryptische Legierung eingehen. Das Wetter, die Anzeigen, das Paar, der Goldmund, die Briennerstraße 8 in unserem Beispiel sind sogenannte Tatsachen der sogenannten Realität, stützen sich also auf recherchierbare Exformationen, also auf das, was uns der Text nicht auf die Nase bindet, was wir aber brauchen, um ihn zu verstehen.
Sie hören längst die argumentative Nachtigall trapsen: Joyce, der radikalste aller Heimatschriftsteller schert sich keinen Deut darum, wie es uns gelingen mag, aus der Flut der lokalen Details, die seinen Ulysses füllen, Welt-Alltag der Epoche zu generieren, aber er weiß, dass nur die Verankerung im verifizierbaren Alltag sein fiktionales Riesengewölbe tragfähig erhält. Der Weltbürger muss sich erst einheimisch machen, wenn er diesen Weltalltag authentisch erleben und verstehen will, sonst bleibt er lesender Zaungast, Postkartentourist, Hausierer mit den Stereotypen sekundärer Urteile. Denken Sie an Günter Eichs T-Shirt-Slogan: „Statt Sekundärliteratur bin ich krank.“
Sie verstehen: Ulysses ist also notwendigerweise eine Zumutung: Er vereint die Unverschämtheit des Alten Testaments, das uns in stetig wechselnden nahöstlichen Wüstenhintertupfingen mit klein- und großkriminell agierenden Nomaden in den Hauptrollen ein Welt- und Heilsdrama universaler Bedeutung vorstellen will, er hat die Unverfrorenheit von Moby Dick für jeden, der seinen Lebensunterhalt nicht mit Walfang verdient und den nervtötenden Klüngelfetischismus von Prousts Suche nach der eben damit verlorenen Zeit oder um Fritz Senn zu zitieren – und das tut man mit schöner, oft unfreiwilliger Regelmäßigkeit, wenn man über Joyce spricht: „Joyce erscheint als einer der rücksichtslosesten Schriftsteller, dem der Leser gleichgültig bleibt: er erklärt nicht, stellt einfach hin, gibt Zeichen ohne die Anleitung, wie sie zu deuten sind.“
Also alles wie im richtigen Leben. Laufend passiert etwas und wir basteln uns mit Hilfe einer, wie wir seit Kant wissen könnten, modellierenden, nicht abbildenden Kausalität Geschichten daraus. Laufend passieren den Dublinern, die den Ulysses bevölkern, ihre Geschichten. In der Tat laufend: Wir sollten beim Lesen des Ulysses nicht vergessen, dass wir uns in einer Welt des Fußgängertempos befinden. Die schnellste Bewegung in Dublin an diesem Tag dürften die Radrennfahrer im Trinity College Park vollführen. Die Wegstrecke, die Leopold Bloom am 16. Juni im schwarzen Anzug zu Fuß zurücklegt, liegt allemal im Halbmarathonbereich.
James Joyce 1904 (l.); in Zürich 1918 (r.).
Joyce ist ein realitätsbesessener Schriftsteller, ein Neuarrangeur des Vorhandenen, ein detailverliebter Collagist von auto- und fremdbiographischen Erlebenspartikeln, Straßen- und Stadtmobiliar, Subtextfragmenten aller nur denkbaren Herkunft (Geräusche, Fetzen gesprochenen Wortes, Liedzeilen, Homer, Dante, Shakespeare, Zeitungsmeldungen, entlegenste Literatur, Katzensprache). Er besteht darauf, dass unsere Bewusstseinsinhalte nicht aus individuellen Seelenschächten herausgeschleudertes originäres Magma sind, sondern das wiedergekäute Irish Stew all dessen, was wir lebenszeitlich verschlungen haben. Von Geburt an sind wir medias in res und folgerichtig taucht uns Joyce von Episode zu Episode, nicht selten von Absatz zu Absatz, ja von Satzteil zu Satzteil eiskalt ins heilignüchterne Wasser dieses Welt-Alltags der Epoche.
Die Realitätsbesessenheit des Ulysses macht die in ihm dokumentierte Welt befragbar, rekonstruierbar, begehbar. Das Innenleben seiner Personen befindet sich in ständigem Rekurs auf die Dingfestigkeit und Lebensmechanik des Dublin der Jahrhundertwende. Stimmigkeit und Präzision im kleinsten Detail war für Joyce ein Wertmaßstab bei der Beurteilung von Literatur. So erbost er sich in einem Brief an seinen Bruder Stani, nachdem er The Wild Goose von George Moore gelesen hatte: „Eine Dame, die seit drei Jahren an der Eisenbahnstrecke zwischen Bray und Dublin wohnt, erfährt von ihrem Mann, dass in Dublin eine Versammlung stattfindet, an der er teilnehmen muss. Sie sieht auf dem Fahrplan die Abfahrtszeiten nach. Und das bei der Dublin-Wicklow-Wexford Linie, deren Züge regelmäßig verkehren: das nach drei Jahren: Das ist doch wohl ziemlich blöd von Moore.“ Wir sollten das im Kopf behalten, wenn wir uns später Gedanken machen, wie Stephen Dedalus von Dalkey nach Sandymount kommt. Als Bloom in den frühen Morgenstunden des Freitags in Begleitung von Stephen Dedalus nach Hause kommt, stellt er fest, dass er – wie sein Begleiter – ohne Schlüssel ist. Um seine Frau (und die Nachbarn?) nicht zu wecken, lässt er sich in den Lichtschacht vor der Küche im Souterain hinunterfallen. Aber bevor ihm das zugemutet wird, hat sein fürsorglicher Verfasser mit einem Brandbrief die Tante in die Eccles Street geschickt, um herauszufinden, ob dieses Manöver denn auch gesundheitsverträglich ist.
Wie sehr Joyce davon überzeugt war, dass pars pro toto sich zur künstlerischen Maxime ausweiten lässt, kann diese bekannte Anekdote belegen: Der irische Maler Patrick Tuohy machte sich bei einer Porträtsitzung mit Joyce lauthals Gedanken darüber, wie wichtig es für den Maler sei, die Seele seines Gegenstandes zu erfassen: „Kümmern Sie sich nicht um meine Seele“, bekam er daraufhin von seinem Sujet zu hören, „sehen Sie zu, dass Sie meine Krawatte richtig hinbekommen!“
Der vorliegende Beitrag ist eine leicht geänderte Fassung eines Vortrags, den Harald Beck 2004 anlässlich der Veranstaltungsreihe ![]() „100 Jahre Bloomsday“ im Literaturhaus München gehalten hat.
„100 Jahre Bloomsday“ im Literaturhaus München gehalten hat.
Joyce-Kenner Harald Beck über die Realitätsbesessenheit eines Romans, der auch in München hätte spielen können
Mit seinem Roman Ulysses erlangte der irische Schriftsteller James Joyce (1882-1941), der heute vor 134 Jahren geboren wurde, Weltruhm. Sein Werk steckt voller Bezüge zur zeitgenössischen Lebenswelt des Autors, dem Dublin der Jahrhundertwende, das der Leser auf seiner Odyssee durchstreift. Mit einer Münchner lokalpatriotischen Variante erklärt der Joyce-Herausgeber und Übersetzer Harald Beck, warum es auch heute noch lohnt, Joyce (wieder) zu lesen.
Wenn Leopold Bloom – und sollten Sie nicht wissen, ![]() wer das ist, dann können Sie jetzt noch diskret die Flucht ergreifen – also, wenn Leopold Bloom in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 1904 nach circa 16-stündiger Stadtodyssee wieder sein Wohnzimmer betritt, stößt er sich unversehens den Kopf an. (Vergessen Sie nicht, dass Privathaushalte 1904 kein elektrisches Licht hatten! Bloom marschiert mit der Kerze durchs nächtliche Haus.) Seine Frau, die am Nachmittag zum ersten Mal von ihrem Liebhaber besucht wurde, hat die Möbel im Wohnzimmer umgestellt. Mit seinen Lesern springt Joyce noch wesentlich robuster um: Uns stößt er auf jeder Seite vor den Kopf unserer Lesegewohnheiten, Denkfaulheiten, unreflektierten Erwartungen, Rezeptionsklischees. Die Irrfahrten des Dubliner Odysseus sind auch die des Lesers: Schiffbrüche und der Verlust von Gefährten drohen allemal.
wer das ist, dann können Sie jetzt noch diskret die Flucht ergreifen – also, wenn Leopold Bloom in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 1904 nach circa 16-stündiger Stadtodyssee wieder sein Wohnzimmer betritt, stößt er sich unversehens den Kopf an. (Vergessen Sie nicht, dass Privathaushalte 1904 kein elektrisches Licht hatten! Bloom marschiert mit der Kerze durchs nächtliche Haus.) Seine Frau, die am Nachmittag zum ersten Mal von ihrem Liebhaber besucht wurde, hat die Möbel im Wohnzimmer umgestellt. Mit seinen Lesern springt Joyce noch wesentlich robuster um: Uns stößt er auf jeder Seite vor den Kopf unserer Lesegewohnheiten, Denkfaulheiten, unreflektierten Erwartungen, Rezeptionsklischees. Die Irrfahrten des Dubliner Odysseus sind auch die des Lesers: Schiffbrüche und der Verlust von Gefährten drohen allemal.
Bevor wir gemeinsam mit den Hauptfiguren des Romans durch Dublin und seine nähere Umgebung irren, möchte ich Ihnen Reiz und Schwierigkeiten der Ulysses-Lektüre mit einer lokalpatriotischen Variante nahebringen. Lassen wir Ulysses kurzfristig in München spielen. Das hatte damals immerhin schon 600.000 Einwohner (Dublin gerade 400.000). Donnerstag, den 16. Juni 1904 ersetzen wir durch Freitag, den 10. November 1916. In dieser isarmetropolitischen Odyssee ist für die Abendstunden eine Episode vorgesehen, in der unser Held, Leopold Blume, er akquiriert Annoncen für die München-Augsburger Zeitung und seine Frau heißt Anna, eine geborene Schwitters, hier unter unseren nostalgischen Nasen am Salvatorplatz vorbei schlendert. Es ist kühl und neblig, der Steckrüben-Winter dräut, Poldis Gedanken sind bei Anzeigen und Meldungen vom Tage: Weihnachten im Feld, starb den Heldentod, Hoflieferant Paul Samberger, Nussbaumstraße 16, künstliche Arme und Beine in vorzüglicher Ausführung, Interessenten steht der illustrierte Katalog A41/B42 zur Verfügung, Hygiene der Ehe, ob der Herr Impressario, mit dem Anna den Nachmittag verbracht hat, sich was drum schert? Die üblichen Druckfehler: Togal rztlich Aeempfohlen gegen Kopfschmerzen. In diesem Augenblick begegnet er einem elegant gekleideten Paar um die Dreißig, das von der Prannerstraße kommend durch die Promenadenstraße jetzt eher zügigen Schritts der Briennerstraße zustrebt.
Der Herr auffallend groß und schlank. Der Tonfall fällt ihm auf, Preißn san des und im Licht einer Straßenlaterne sieht er ungläubig, dass der ganze Mund der Dame lückenlos goldüberkront schimmert. Schiach schaugt des aus. Neugierig folgt er dem Paar, bis es nach kurzem orientierenden Zögern im Luitpoldblock, Eingang Briennerstraße 8 verschwindet. Spät nachts wird sich der Herr in einem ironischen Rollentausch der erwartungsfrohen Dame gegenüber auf eine Migräne berufen und das Nichtehepaar sinkt in seine getrennten Betten in einfachen Schlafzimmern mit Bad, zwei Sesseln, großem Spiegel, Perserteppich, Goldrandspiegel, Frisierkommode und elektrischem Licht.
Welchen Heimvorteil hätte der zeitgenössische Münchner in unserem Fall gegenüber einem – sagen wir irischen Leser des Jahres 2016? Er würde die Prannerstraße und zwei ortsunkundige, elegant gekleidete Preißn ziemlich sicher mit dem Bayerischen Hof verbinden, die Briennerstraße 8 zumindest mit dem Café Luitpold, vielleicht sogar mit der Kunsthandlung Goltz. Aber auch er hätte nicht gewusst, es sei denn, er hätte Rilke geheißen, dass an diesem Abend dort in einem kalten, schlecht beleuchteten Saal im 1. Stock, in dem expressionistische Bilder hingen, der Fontane-Preisträger Dr. Franz Kafka ein paar Gedichte von Max Brod und seine „schmutzige kleine Geschichte“ In der Strafkolonie vortrug. Felice Bauer war extra aus Berlin angereist zu diesem ersten Treffen, nachdem sie im Juli in Marienbad miteinander vertraut geworden waren. Auch in manch anderer Hinsicht eine gespenstische Episode. Es soll unter den Zuhörerinnen zu Ohnmachten gekommen sein.
Bucherstausgabe des Ulysses von 1922 (l.); Leopold Bloom, Zeichnung von James Joyce (r.).
Ulysses enthält viele hunderte solcher Momente, in denen Fiktion und Faktisch-Historisches eine kryptische Legierung eingehen. Das Wetter, die Anzeigen, das Paar, der Goldmund, die Briennerstraße 8 in unserem Beispiel sind sogenannte Tatsachen der sogenannten Realität, stützen sich also auf recherchierbare Exformationen, also auf das, was uns der Text nicht auf die Nase bindet, was wir aber brauchen, um ihn zu verstehen.
Sie hören längst die argumentative Nachtigall trapsen: Joyce, der radikalste aller Heimatschriftsteller schert sich keinen Deut darum, wie es uns gelingen mag, aus der Flut der lokalen Details, die seinen Ulysses füllen, Welt-Alltag der Epoche zu generieren, aber er weiß, dass nur die Verankerung im verifizierbaren Alltag sein fiktionales Riesengewölbe tragfähig erhält. Der Weltbürger muss sich erst einheimisch machen, wenn er diesen Weltalltag authentisch erleben und verstehen will, sonst bleibt er lesender Zaungast, Postkartentourist, Hausierer mit den Stereotypen sekundärer Urteile. Denken Sie an Günter Eichs T-Shirt-Slogan: „Statt Sekundärliteratur bin ich krank.“
Sie verstehen: Ulysses ist also notwendigerweise eine Zumutung: Er vereint die Unverschämtheit des Alten Testaments, das uns in stetig wechselnden nahöstlichen Wüstenhintertupfingen mit klein- und großkriminell agierenden Nomaden in den Hauptrollen ein Welt- und Heilsdrama universaler Bedeutung vorstellen will, er hat die Unverfrorenheit von Moby Dick für jeden, der seinen Lebensunterhalt nicht mit Walfang verdient und den nervtötenden Klüngelfetischismus von Prousts Suche nach der eben damit verlorenen Zeit oder um Fritz Senn zu zitieren – und das tut man mit schöner, oft unfreiwilliger Regelmäßigkeit, wenn man über Joyce spricht: „Joyce erscheint als einer der rücksichtslosesten Schriftsteller, dem der Leser gleichgültig bleibt: er erklärt nicht, stellt einfach hin, gibt Zeichen ohne die Anleitung, wie sie zu deuten sind.“
Also alles wie im richtigen Leben. Laufend passiert etwas und wir basteln uns mit Hilfe einer, wie wir seit Kant wissen könnten, modellierenden, nicht abbildenden Kausalität Geschichten daraus. Laufend passieren den Dublinern, die den Ulysses bevölkern, ihre Geschichten. In der Tat laufend: Wir sollten beim Lesen des Ulysses nicht vergessen, dass wir uns in einer Welt des Fußgängertempos befinden. Die schnellste Bewegung in Dublin an diesem Tag dürften die Radrennfahrer im Trinity College Park vollführen. Die Wegstrecke, die Leopold Bloom am 16. Juni im schwarzen Anzug zu Fuß zurücklegt, liegt allemal im Halbmarathonbereich.
James Joyce 1904 (l.); in Zürich 1918 (r.).
Joyce ist ein realitätsbesessener Schriftsteller, ein Neuarrangeur des Vorhandenen, ein detailverliebter Collagist von auto- und fremdbiographischen Erlebenspartikeln, Straßen- und Stadtmobiliar, Subtextfragmenten aller nur denkbaren Herkunft (Geräusche, Fetzen gesprochenen Wortes, Liedzeilen, Homer, Dante, Shakespeare, Zeitungsmeldungen, entlegenste Literatur, Katzensprache). Er besteht darauf, dass unsere Bewusstseinsinhalte nicht aus individuellen Seelenschächten herausgeschleudertes originäres Magma sind, sondern das wiedergekäute Irish Stew all dessen, was wir lebenszeitlich verschlungen haben. Von Geburt an sind wir medias in res und folgerichtig taucht uns Joyce von Episode zu Episode, nicht selten von Absatz zu Absatz, ja von Satzteil zu Satzteil eiskalt ins heilignüchterne Wasser dieses Welt-Alltags der Epoche.
Die Realitätsbesessenheit des Ulysses macht die in ihm dokumentierte Welt befragbar, rekonstruierbar, begehbar. Das Innenleben seiner Personen befindet sich in ständigem Rekurs auf die Dingfestigkeit und Lebensmechanik des Dublin der Jahrhundertwende. Stimmigkeit und Präzision im kleinsten Detail war für Joyce ein Wertmaßstab bei der Beurteilung von Literatur. So erbost er sich in einem Brief an seinen Bruder Stani, nachdem er The Wild Goose von George Moore gelesen hatte: „Eine Dame, die seit drei Jahren an der Eisenbahnstrecke zwischen Bray und Dublin wohnt, erfährt von ihrem Mann, dass in Dublin eine Versammlung stattfindet, an der er teilnehmen muss. Sie sieht auf dem Fahrplan die Abfahrtszeiten nach. Und das bei der Dublin-Wicklow-Wexford Linie, deren Züge regelmäßig verkehren: das nach drei Jahren: Das ist doch wohl ziemlich blöd von Moore.“ Wir sollten das im Kopf behalten, wenn wir uns später Gedanken machen, wie Stephen Dedalus von Dalkey nach Sandymount kommt. Als Bloom in den frühen Morgenstunden des Freitags in Begleitung von Stephen Dedalus nach Hause kommt, stellt er fest, dass er – wie sein Begleiter – ohne Schlüssel ist. Um seine Frau (und die Nachbarn?) nicht zu wecken, lässt er sich in den Lichtschacht vor der Küche im Souterain hinunterfallen. Aber bevor ihm das zugemutet wird, hat sein fürsorglicher Verfasser mit einem Brandbrief die Tante in die Eccles Street geschickt, um herauszufinden, ob dieses Manöver denn auch gesundheitsverträglich ist.
Wie sehr Joyce davon überzeugt war, dass pars pro toto sich zur künstlerischen Maxime ausweiten lässt, kann diese bekannte Anekdote belegen: Der irische Maler Patrick Tuohy machte sich bei einer Porträtsitzung mit Joyce lauthals Gedanken darüber, wie wichtig es für den Maler sei, die Seele seines Gegenstandes zu erfassen: „Kümmern Sie sich nicht um meine Seele“, bekam er daraufhin von seinem Sujet zu hören, „sehen Sie zu, dass Sie meine Krawatte richtig hinbekommen!“
Der vorliegende Beitrag ist eine leicht geänderte Fassung eines Vortrags, den Harald Beck 2004 anlässlich der Veranstaltungsreihe ![]() „100 Jahre Bloomsday“ im Literaturhaus München gehalten hat.
„100 Jahre Bloomsday“ im Literaturhaus München gehalten hat.