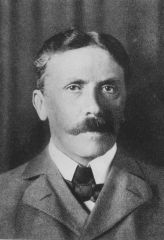Josef Ruederer
Josef Anton Heinrich Ruederer wird 1861 in München geboren. Sein Vater ist Großaktionär der Bayerischen Handelsbank und der Löwenbrauerei sowie portugiesischer Generalkonsul, seine Mutter stammt aus einer reichen Bierbrauerfamilie. Nach dem Gymnasium und dem Militär macht Ruederer von 1882-1885 eine kaufmännische Ausbildung bei einer Bank, danach studiert er in Berlin, schließt mit einer Promotion ab.
Als das Stahlwerk Bankrott macht, dessen Teilhaber er ist, lebt er forthin als freier Schriftsteller und vom Vermögen seines Vaters. Zuerst wohnt er in Schwabing, zwischenzeitlich in Farchant bei Garmisch, dann wieder in München, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Man verortet ihn im Umkreis der Münchner Secession, seine Kritik an Korruption, Heuchelei, Vetternwirtschaft und Bigotterie macht ihn bekannt, Ludwig Thoma zählt bald zu seinen Feinden.
1896 ist er Mitbegründer des Intimen Theaters, 1901 des Kabaretts Die Elf Scharfrichter, er veröffentlicht in August Scherls Berliner Intellektuellenblatt Der Tag und wird Sozietär der Süddeutschen Monatshefte. Von 1908 bis 1912 arbeitet er als Mitglied des Theaterzensurbeirates, schreibt selbst einige Dramen, darunter vor allem Komödien. Ein mehrbändiges Romanwerk über die Entwicklung der Stadt München zur Zeit König Ludwig I. kann der Autor nicht mehr vollenden, denn er stirbt am 20. Oktober 1915 in München. Posthum wurde der erste Teil 1916 unter dem Titel Das Erwachen veröffentlicht.
Sekundärliteratur:
Hübner, Klaus (2013): Eine Liebeserklärung von gestern. Josef Ruederer – zu Recht in Thomas Schatten. In: Literatur in Bayern 112, H. 2, S. 51f.
Müller-Stratmann, Claudia (1994): Josef Ruederer (1861-1915). Leben und Werk eines Münchner Dichters der Jahrhundertwende (Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft: Reihe B/Untersuchungen, 56). Peter Lang, Frankfurt am Main u.a.
Puknus, Heinz (2004): Josef Ruederer (15.10.1861 – 20.10.1915). Literarischer Neuerer. In: Schweiggert, Alfons; Macher, Hannes S. (Hg.): Autoren und Autorinnen in Bayern. 20. Jahrhundert. Bayerland Verlag, Dachau, S. 31-33.
Schrott, Ludwig (1967): Josef Ruederer. In: Dünninger, Eberhard; Kiesselbach, Dorothee (Hg.): Bayerische Literaturgeschichte in ausgewählten Beispielen II. Süddeutscher Verlag, München, S. 326-335.
Stephan, Michael (2015): Ein ausgesprochener München-Autor. Über Josef Ruederer (1861-1915). In: Literatur in Bayern 30. Jg., H. 121, S. 40-43.
Weichslgartner, Alois J. (2001): Schreiber und Poeten. Schriftsteller aus Altbayern und Schwaben im 19. Jahrhundert. Bayerland Druckerei und Verlagsanstalt, Dachau.
Externe Links:
![]() Literatur von Josef Ruederer im BVB
Literatur von Josef Ruederer im BVB
![]() Literatur über Josef Ruederer im BVB
Literatur über Josef Ruederer im BVB
Josef Anton Heinrich Ruederer wird 1861 in München geboren. Sein Vater ist Großaktionär der Bayerischen Handelsbank und der Löwenbrauerei sowie portugiesischer Generalkonsul, seine Mutter stammt aus einer reichen Bierbrauerfamilie. Nach dem Gymnasium und dem Militär macht Ruederer von 1882-1885 eine kaufmännische Ausbildung bei einer Bank, danach studiert er in Berlin, schließt mit einer Promotion ab.
Als das Stahlwerk Bankrott macht, dessen Teilhaber er ist, lebt er forthin als freier Schriftsteller und vom Vermögen seines Vaters. Zuerst wohnt er in Schwabing, zwischenzeitlich in Farchant bei Garmisch, dann wieder in München, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Man verortet ihn im Umkreis der Münchner Secession, seine Kritik an Korruption, Heuchelei, Vetternwirtschaft und Bigotterie macht ihn bekannt, Ludwig Thoma zählt bald zu seinen Feinden.
1896 ist er Mitbegründer des Intimen Theaters, 1901 des Kabaretts Die Elf Scharfrichter, er veröffentlicht in August Scherls Berliner Intellektuellenblatt Der Tag und wird Sozietär der Süddeutschen Monatshefte. Von 1908 bis 1912 arbeitet er als Mitglied des Theaterzensurbeirates, schreibt selbst einige Dramen, darunter vor allem Komödien. Ein mehrbändiges Romanwerk über die Entwicklung der Stadt München zur Zeit König Ludwig I. kann der Autor nicht mehr vollenden, denn er stirbt am 20. Oktober 1915 in München. Posthum wurde der erste Teil 1916 unter dem Titel Das Erwachen veröffentlicht.
Hübner, Klaus (2013): Eine Liebeserklärung von gestern. Josef Ruederer – zu Recht in Thomas Schatten. In: Literatur in Bayern 112, H. 2, S. 51f.
Müller-Stratmann, Claudia (1994): Josef Ruederer (1861-1915). Leben und Werk eines Münchner Dichters der Jahrhundertwende (Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft: Reihe B/Untersuchungen, 56). Peter Lang, Frankfurt am Main u.a.
Puknus, Heinz (2004): Josef Ruederer (15.10.1861 – 20.10.1915). Literarischer Neuerer. In: Schweiggert, Alfons; Macher, Hannes S. (Hg.): Autoren und Autorinnen in Bayern. 20. Jahrhundert. Bayerland Verlag, Dachau, S. 31-33.
Schrott, Ludwig (1967): Josef Ruederer. In: Dünninger, Eberhard; Kiesselbach, Dorothee (Hg.): Bayerische Literaturgeschichte in ausgewählten Beispielen II. Süddeutscher Verlag, München, S. 326-335.
Stephan, Michael (2015): Ein ausgesprochener München-Autor. Über Josef Ruederer (1861-1915). In: Literatur in Bayern 30. Jg., H. 121, S. 40-43.
Weichslgartner, Alois J. (2001): Schreiber und Poeten. Schriftsteller aus Altbayern und Schwaben im 19. Jahrhundert. Bayerland Druckerei und Verlagsanstalt, Dachau.