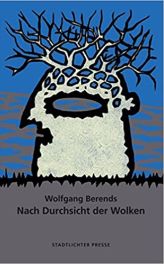Gibt es ein Lesen nach dem Tod? Über ein Gedicht von Wolfgang Berends
Die 142. Ausgabe der Zeitschrift Literatur in Bayern widmet sich dem Schwerpunktthema kostbar. Pia-Elisabeth Leuschner, Mitarbeiterin des Lyrik Kabinetts in München, schreibt darin über ein Gedicht aus Wolfgang Berends Band Nach Durchsicht der Wolken. Für das Literaturportal Bayern hat sie ihren Beitrag nochmals erweitert.
*
Gibt es ein Lesen nach dem Tod?
Leben, von vorne. Ge-
lesen Nebel, rückwärts.
Weg ist die Zeit.
Leben ist immer
schon. Anders ist
die Form. Dein Augen-
blick ist eben. Ein
Verstreichen. Du läßt
eine Spur Nebel.
Aus: Nach Durchsicht der Wolken (Stadtlichter Presse 2016), S. 73.
„Seltsam, im Nebel zu wandern …“ (Hermann Hesse) oder „Wanderer, ’s gibt keine Wege, Du bist Deine Spuren im Meer.“ (Antonio Machado) … Es ist kein Zufall, dass das obige Gedicht von Wolfgang Berends eine ganze Wolke von Assoziationen auslöst. Denn es ist eine Vexierfigur, aus der uns nicht nur Grundfragen der menschlichen und künstlerischen Existenz anfallen, sondern auch gleich mehrere, vieldeutig ineinander kondensierte Aussagen oder Kunstwerke.
Den Titel mag man spontan noch für eine jener provokanten Deformationen idiomatischer Redewendungen halten, wie Berends sie gern einsetzt (nicht zuletzt als Kritik an Religion oder metaphysischem Denken), und in Vers 1-2 beglückwünscht man sich vielleicht noch dazu, dass man die ebenso ingeniöse wie letztlich struktur-schlichte Trouvaille begriffen hat: ‚Leben‘, rückwärts gelesen, ergibt ‚Nebel‘ … Dann aber zieht uns Vers 3 den Boden der Eindeutigkeit unter den Füßen weg. Denn während wir noch das taoistische Wort „Der Weg ist das Ziel“ erinnern, entgleiten uns sowohl Ziel wie Zeit – da die Zeit hier nicht nur Weg ist, sondern auch schlicht weg, fort.
Ab hier wandert unsere Sinnbildung tatsächlich wie im Nebel – bzw. im Spannungsfeld jener doppelten Blickrichtung, die unser Dasein prägt: Wir leben vorwärts und versuchen rückschauend unseren Werdegang sinn-stiftend zu ‚lesen‘. Und wie der Lebensfluss uns über alle haltgebenden Demarkationen – hier symbolisiert durch Zeilenbrüche und Interpunktion – hinwegstrudelt und jeder Erfahrungsschritt das Vergangene in einem neuen Licht erscheinen lassen kann, eröffnet jedes hinzukommende Wort eine veränderte Perspektive: „Leben ist immer schon“ – alles kommt irgendwie verfrüht, speziell etwa das Altern. „Leben ist immer schon anders“ in dem Moment, in dem wir es retrospektiv rationalisieren, denn „Anders [als das Leben] ist die Form“, die wir ihm dadurch überstülpen: Sie fließt nicht mehr, sondern fixiert.
„Leben ist immer schon anders, ist die Form: Dein Augenblick.“ Mehr als solche Gegenwartsimmanenz haben wir ja nie, da die Vergangenheit weg und die Zukunft noch nicht da ist. Darum gilt: „Dein Augenblick ist eben ein Verstreichen“ … Wenn die letzten Verse dieses gefühlt unaufhaltsame Sinn-(Ent-)Gleiten lapidar stillstellen: „Du lässt eine Spur Nebel“, akzeptiert man sie, wie aus Erleichterung, in ihrer scheinbar radikal-pessimistischen Bedeutung: Nichts bleibt von uns als Zerfließendes. Erst im Jenseits des Gedichts wird uns bewusst, dass dieser Satz – mit dem Leben-Nebel-Anagramm gedacht– auch lediglich meinen kann: ‚Post mortem lesen und deuten wir das Leben von seinem Ende her‘.
Nun ist der Augenblick hier auch deshalb „eben“ (d.h. zweidimensional) und „ein Verstreichen“, weil sich Berends‘ Gedicht auf Werke des in Schondorf wirkenden Künstlers ![]() Andreas Kloker bezieht. Der malt u.a. mit bloßem klarem Wasser auf einer Tafel, so dass das ‚Verstrichene‘ jeweils wegverdunstet … Kloker selbst sagt über eine seiner Performances, „dass sich da an der Pinselspitze etwas ereignet, dass da das Leben entsteht und auch der Tod, dass da Zeit entsteht".
Andreas Kloker bezieht. Der malt u.a. mit bloßem klarem Wasser auf einer Tafel, so dass das ‚Verstrichene‘ jeweils wegverdunstet … Kloker selbst sagt über eine seiner Performances, „dass sich da an der Pinselspitze etwas ereignet, dass da das Leben entsteht und auch der Tod, dass da Zeit entsteht".
Auch an der ‚Pinselspitze‘ des Dichters entstehen Leben, Tod und Zeit: in uns, als gesteigertes Bewusstsein dieser Grundkoordinaten unseres Daseins. Infolge unserer vorwärts wie rückwärts so nebelbeschränkten Sicht werden wir zwar nie wissen, ob es ein Lesen nach dem Tod gibt. Dafür aber lässt uns große facettenreiche Kunst immer neu erfahren, was Berends‘ Gedicht zudem in die Form einer prägnanten Erkenntnis fasst. Denn wann immer es einen solchen Lektüre-Moment gibt, bezeugen der Dichter und seine Leserschaft – über jede historische Distanz hinweg, und sei’s in unvollständigster Sichtweise – einander wechselseitig: „Dein Augenblick ist [L]eben“.
**
Und das gilt nur umso schlüssiger aufgrund von weiteren Aspekten des Gedichts, die bislang nicht berücksichtigt wurden.
Denn auch das Lesen hat letztlich eine doppelte Gerichtetheit. Es steht nicht nur (wie es in meinen bisherigen Ausführungen aufgefasst wurde) für eine im Abendland traditionelle Chiffre des rückwärts-schauenden Sinnstiftens im eigenen Lebensgang, sondern es ist auch seinerseits prozesshaft und ein Vorwärtsstreben – anderenfalls könnte die oben gezeigte progressive Anreicherung und Modifikation der Bedeutungen in Berends‘ Gedicht nicht funktionieren. Dass ‚Leben‘ und ‚Lesen‘ diese doppelte Ausrichtung gemeinsam haben, unterstreicht das Gedicht u.a. durch die Worttrennung des Partizips am Übergang von Vers 1 zu 2, so dass die beiden bis auf einen Buchstaben gleichen Worte untereinander zu stehen kommen. Das zeigt: Solange wir leben, kann auch das Lesen nie etwas anderes sein als eine an die Dimension der Zeit gebundene Aktivität.
Fasst man nun die Struktur des Gedichts noch einmal näher ins Auge, fällt eine wichtige Symmetrie auf: Es beginnt mit dem Wort ‚Leben‘ und endet mit dem spiegelbildlichen ‚Nebel‘. Diese Entsprechung selbst ist ein räumlich-formales Phänomen, das sich zwar im Zuge der Lektüre zeitlich erschließt, das aber nach dem Lesen mit einem einzigen Blick zeit-enthoben wahrnehmbar wird – als Kreisförmigkeit oder Ringschluss.
Um diese Tatsache zu deuten, bietet sich ein Ausgreifen auf eine andere abendländische Denktradition an, von der hier nur einige exemplarische Namen genannt seien: Von Augustinus über Kant bis hin zu aktuellen Vertretern des ‚Neuen Materialismus‘ (etwa Karen Barad, geb. 1956) oder der christlich-jesuitischen Philosophie (etwa Gerd Haeffner, 1941–2016) wird immer wieder betont, dass Raum und Zeit maßgeblich innerhalb des menschlichen Bewusstseins ent- und bestehen, dass sie unsere Wahrnehmungsweise in diesem Leben unhintergehbar prägen, dass aber jenseits des Todes eine Art des Erlebens anzunehmen ist, die von diesen Kategorien unabhängig und als nicht mehr zeit- oder raumbedingte zu denken ist.
Indem nun Berends‘ Gedicht sowohl – in der Lektüre-Erfahrung – seine eigene Zeitlichkeit in sich trägt, als auch – mit seiner formalen Symmetrie – seinen eigenen Erfahrungsraum bildet, spiegelt es nicht zuletzt die diesseitige, von Raum und Zeit grundierte Struktur des menschlichen Bewusstseins. Doch sobald wir das Gedicht gelesen haben und die neun Verse nun als ein Ganzes und eine in sich begrenzte Raumzeit überschauen, der wir selbst entwachsen sind, zeigen sich markante Parallelen zu der Wahrnehmungsweise, die wir uns mit höchster Wahrscheinlichkeit post mortem vorzustellen haben: ein Sehen dann aus dem Jenseits auch von Raum und Zeit.
FALLS es also ein Lesen nach dem Tod gibt, dann bietet uns Berends‘ Gedicht das triftigste formale Äquivalent für jene uns jetzt noch unvorstellbare Wahrnehmungsweise. Und wofern es das wäre, was uns nach dem Lebensende erwartet, kann doch jeder Leser oder jede Leserin nur sagen: ein Ziel, dem wir mit hellst ungeduldiger Erwartung und Vorfreude entgegengehen dürfen.
***
Wolfgang Berends, geb. 1965, ist Lyriker und Rezensent und arbeitet als Bibliothekar der Stiftung Lyrik Kabinett. Zuletzt erschien von ihm Nach Durchsicht der Wolken (Stadtlichterpresse 2016).
Gibt es ein Lesen nach dem Tod? Über ein Gedicht von Wolfgang Berends
Die 142. Ausgabe der Zeitschrift Literatur in Bayern widmet sich dem Schwerpunktthema kostbar. Pia-Elisabeth Leuschner, Mitarbeiterin des Lyrik Kabinetts in München, schreibt darin über ein Gedicht aus Wolfgang Berends Band Nach Durchsicht der Wolken. Für das Literaturportal Bayern hat sie ihren Beitrag nochmals erweitert.
*
Gibt es ein Lesen nach dem Tod?
Leben, von vorne. Ge-
lesen Nebel, rückwärts.
Weg ist die Zeit.
Leben ist immer
schon. Anders ist
die Form. Dein Augen-
blick ist eben. Ein
Verstreichen. Du läßt
eine Spur Nebel.
Aus: Nach Durchsicht der Wolken (Stadtlichter Presse 2016), S. 73.
„Seltsam, im Nebel zu wandern …“ (Hermann Hesse) oder „Wanderer, ’s gibt keine Wege, Du bist Deine Spuren im Meer.“ (Antonio Machado) … Es ist kein Zufall, dass das obige Gedicht von Wolfgang Berends eine ganze Wolke von Assoziationen auslöst. Denn es ist eine Vexierfigur, aus der uns nicht nur Grundfragen der menschlichen und künstlerischen Existenz anfallen, sondern auch gleich mehrere, vieldeutig ineinander kondensierte Aussagen oder Kunstwerke.
Den Titel mag man spontan noch für eine jener provokanten Deformationen idiomatischer Redewendungen halten, wie Berends sie gern einsetzt (nicht zuletzt als Kritik an Religion oder metaphysischem Denken), und in Vers 1-2 beglückwünscht man sich vielleicht noch dazu, dass man die ebenso ingeniöse wie letztlich struktur-schlichte Trouvaille begriffen hat: ‚Leben‘, rückwärts gelesen, ergibt ‚Nebel‘ … Dann aber zieht uns Vers 3 den Boden der Eindeutigkeit unter den Füßen weg. Denn während wir noch das taoistische Wort „Der Weg ist das Ziel“ erinnern, entgleiten uns sowohl Ziel wie Zeit – da die Zeit hier nicht nur Weg ist, sondern auch schlicht weg, fort.
Ab hier wandert unsere Sinnbildung tatsächlich wie im Nebel – bzw. im Spannungsfeld jener doppelten Blickrichtung, die unser Dasein prägt: Wir leben vorwärts und versuchen rückschauend unseren Werdegang sinn-stiftend zu ‚lesen‘. Und wie der Lebensfluss uns über alle haltgebenden Demarkationen – hier symbolisiert durch Zeilenbrüche und Interpunktion – hinwegstrudelt und jeder Erfahrungsschritt das Vergangene in einem neuen Licht erscheinen lassen kann, eröffnet jedes hinzukommende Wort eine veränderte Perspektive: „Leben ist immer schon“ – alles kommt irgendwie verfrüht, speziell etwa das Altern. „Leben ist immer schon anders“ in dem Moment, in dem wir es retrospektiv rationalisieren, denn „Anders [als das Leben] ist die Form“, die wir ihm dadurch überstülpen: Sie fließt nicht mehr, sondern fixiert.
„Leben ist immer schon anders, ist die Form: Dein Augenblick.“ Mehr als solche Gegenwartsimmanenz haben wir ja nie, da die Vergangenheit weg und die Zukunft noch nicht da ist. Darum gilt: „Dein Augenblick ist eben ein Verstreichen“ … Wenn die letzten Verse dieses gefühlt unaufhaltsame Sinn-(Ent-)Gleiten lapidar stillstellen: „Du lässt eine Spur Nebel“, akzeptiert man sie, wie aus Erleichterung, in ihrer scheinbar radikal-pessimistischen Bedeutung: Nichts bleibt von uns als Zerfließendes. Erst im Jenseits des Gedichts wird uns bewusst, dass dieser Satz – mit dem Leben-Nebel-Anagramm gedacht– auch lediglich meinen kann: ‚Post mortem lesen und deuten wir das Leben von seinem Ende her‘.
Nun ist der Augenblick hier auch deshalb „eben“ (d.h. zweidimensional) und „ein Verstreichen“, weil sich Berends‘ Gedicht auf Werke des in Schondorf wirkenden Künstlers ![]() Andreas Kloker bezieht. Der malt u.a. mit bloßem klarem Wasser auf einer Tafel, so dass das ‚Verstrichene‘ jeweils wegverdunstet … Kloker selbst sagt über eine seiner Performances, „dass sich da an der Pinselspitze etwas ereignet, dass da das Leben entsteht und auch der Tod, dass da Zeit entsteht".
Andreas Kloker bezieht. Der malt u.a. mit bloßem klarem Wasser auf einer Tafel, so dass das ‚Verstrichene‘ jeweils wegverdunstet … Kloker selbst sagt über eine seiner Performances, „dass sich da an der Pinselspitze etwas ereignet, dass da das Leben entsteht und auch der Tod, dass da Zeit entsteht".
Auch an der ‚Pinselspitze‘ des Dichters entstehen Leben, Tod und Zeit: in uns, als gesteigertes Bewusstsein dieser Grundkoordinaten unseres Daseins. Infolge unserer vorwärts wie rückwärts so nebelbeschränkten Sicht werden wir zwar nie wissen, ob es ein Lesen nach dem Tod gibt. Dafür aber lässt uns große facettenreiche Kunst immer neu erfahren, was Berends‘ Gedicht zudem in die Form einer prägnanten Erkenntnis fasst. Denn wann immer es einen solchen Lektüre-Moment gibt, bezeugen der Dichter und seine Leserschaft – über jede historische Distanz hinweg, und sei’s in unvollständigster Sichtweise – einander wechselseitig: „Dein Augenblick ist [L]eben“.
**
Und das gilt nur umso schlüssiger aufgrund von weiteren Aspekten des Gedichts, die bislang nicht berücksichtigt wurden.
Denn auch das Lesen hat letztlich eine doppelte Gerichtetheit. Es steht nicht nur (wie es in meinen bisherigen Ausführungen aufgefasst wurde) für eine im Abendland traditionelle Chiffre des rückwärts-schauenden Sinnstiftens im eigenen Lebensgang, sondern es ist auch seinerseits prozesshaft und ein Vorwärtsstreben – anderenfalls könnte die oben gezeigte progressive Anreicherung und Modifikation der Bedeutungen in Berends‘ Gedicht nicht funktionieren. Dass ‚Leben‘ und ‚Lesen‘ diese doppelte Ausrichtung gemeinsam haben, unterstreicht das Gedicht u.a. durch die Worttrennung des Partizips am Übergang von Vers 1 zu 2, so dass die beiden bis auf einen Buchstaben gleichen Worte untereinander zu stehen kommen. Das zeigt: Solange wir leben, kann auch das Lesen nie etwas anderes sein als eine an die Dimension der Zeit gebundene Aktivität.
Fasst man nun die Struktur des Gedichts noch einmal näher ins Auge, fällt eine wichtige Symmetrie auf: Es beginnt mit dem Wort ‚Leben‘ und endet mit dem spiegelbildlichen ‚Nebel‘. Diese Entsprechung selbst ist ein räumlich-formales Phänomen, das sich zwar im Zuge der Lektüre zeitlich erschließt, das aber nach dem Lesen mit einem einzigen Blick zeit-enthoben wahrnehmbar wird – als Kreisförmigkeit oder Ringschluss.
Um diese Tatsache zu deuten, bietet sich ein Ausgreifen auf eine andere abendländische Denktradition an, von der hier nur einige exemplarische Namen genannt seien: Von Augustinus über Kant bis hin zu aktuellen Vertretern des ‚Neuen Materialismus‘ (etwa Karen Barad, geb. 1956) oder der christlich-jesuitischen Philosophie (etwa Gerd Haeffner, 1941–2016) wird immer wieder betont, dass Raum und Zeit maßgeblich innerhalb des menschlichen Bewusstseins ent- und bestehen, dass sie unsere Wahrnehmungsweise in diesem Leben unhintergehbar prägen, dass aber jenseits des Todes eine Art des Erlebens anzunehmen ist, die von diesen Kategorien unabhängig und als nicht mehr zeit- oder raumbedingte zu denken ist.
Indem nun Berends‘ Gedicht sowohl – in der Lektüre-Erfahrung – seine eigene Zeitlichkeit in sich trägt, als auch – mit seiner formalen Symmetrie – seinen eigenen Erfahrungsraum bildet, spiegelt es nicht zuletzt die diesseitige, von Raum und Zeit grundierte Struktur des menschlichen Bewusstseins. Doch sobald wir das Gedicht gelesen haben und die neun Verse nun als ein Ganzes und eine in sich begrenzte Raumzeit überschauen, der wir selbst entwachsen sind, zeigen sich markante Parallelen zu der Wahrnehmungsweise, die wir uns mit höchster Wahrscheinlichkeit post mortem vorzustellen haben: ein Sehen dann aus dem Jenseits auch von Raum und Zeit.
FALLS es also ein Lesen nach dem Tod gibt, dann bietet uns Berends‘ Gedicht das triftigste formale Äquivalent für jene uns jetzt noch unvorstellbare Wahrnehmungsweise. Und wofern es das wäre, was uns nach dem Lebensende erwartet, kann doch jeder Leser oder jede Leserin nur sagen: ein Ziel, dem wir mit hellst ungeduldiger Erwartung und Vorfreude entgegengehen dürfen.
***
Wolfgang Berends, geb. 1965, ist Lyriker und Rezensent und arbeitet als Bibliothekar der Stiftung Lyrik Kabinett. Zuletzt erschien von ihm Nach Durchsicht der Wolken (Stadtlichterpresse 2016).