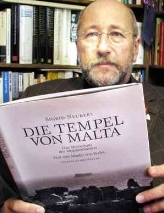Schloss Kaibitz und Erich Ebermayer

Wie das Schloss Kaibitz 1945 mit der Rettung des Gerhart-Hauptmann-Archivs durch den Schriftsteller und Drehbuchautor Erich Ebermayer in den Blickpunkt der deutschen Literatur gelangte. Ein Beitrag von Bernhard M. Baron.
*
Erich Ebermayer (1900-1970), als Sohn eines Oberreichsanwalts in Leipzig geboren, Jurist, Schriftsteller, Theaterdichter und erfolgreicher UFA-Drehbuchautor, genießt in den 1920er- und 1930er-Jahren als Flaneur den Lebensstil eines wohlhabenden Intellektuellen, der zu seinem Freundeskreis Stefan Zweig, Emil Jannings, Gerhart Hauptmann, Gustaf Gründgens, Klaus und Thomas Mann sowie Zarah Leander zählt. Er hält feudal Hof, reist gerne ins Ausland und bleibt in Deutschland, obwohl er „in völkischen Kreisen“ als „Systemdichter“ und „Judenfreund“ gilt. Durch seine bekannt gewordene Homosexualität sucht der in Berlin lebende Erich Ebermayer eine Villa in der Provinz und erwirbt so im Sommer 1939 das kleine historische Wasser- und Hammerschloss Kaibitz am Fuße des Vulkans Rauer Kulm – zu dessen Refugium Ökonomiegebäude und eine Brauerei gehören – unweit der Stadt Kemnath im heutigen Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz.
Schon bald entsteht um sein Oberpfälzer Gut, wo illustre Feste mit Autoren, Künstlern und UFA-Schauspielern gefeiert werden, in Berndorf, Oberndorf, im Landsassengut Unterbruck und Schloss Wolframshof eine stattliche Künstlerkolonie: Carl Friedrich Wilhelm Behl (1889-1968), engster Vertrauter von Gerhart Hauptmann; Peer (eigentlich Ernst-Max) Baedeker (1912-1999), Mitarbeiter und Lebenspartner von Erich Ebermayer; der Literaturwissenschaftler Felix A. Voigt (1892-1962); die baltisch-deutsche Schriftstellerin Gertrud Freiin von den Brincken (1892-1982) sowie die Presse- und Theaterzeichnerin Christa von der Schulenburg (1908-1993) siedeln sich hier an.
Die Vorzeichen des Zweiten Weltkrieges verzeichnet auch das Tagebuch Erich Ebermayers auf seinem Oberpfälzer Wasserschloss:
Kaibitz, 29. August 1939: „Seit drei Tagen, das erfahre ich erst jetzt, wunderte mich nur über die angenehme Ruhe in der Luft, ist ‚Luftsperre‘. Auf dem nahen Militär-Flugplatz Kirchenlaibach steigt kein Flugzeug mehr auf. Einer der wenigen Vorteile dieser großen Zeit. […]“
Kaibitz, 1. September 1939 – Mitternacht: „[…] Die erste Nacht der Verdunkelung! Wieviele werden folgen? Wie ist die geliebte Landschaft auch in dieser ersten Kriegsnacht groß und weit und still! Nichts regt sich in den Lüften.“
Der Grandseigneur und Bonvivant lässt sich vom kommenden Kriegsgeschehen nicht ablenken. Er schreibt und dreht weiter Filme. Jahre später wird er diese Zeit als Teil seiner „Inneren Emigration“ bezeichnen.
**
Die eigentliche Rettung des Gerhart-Hauptmann-Archivs, des sog. „Schatzes vom Wiesenstein“, ist sicherlich C. F. W. Behl zu verdanken, welches ihm Gerhart Hauptmann (1862-1946) am 5. Februar 1945 vor seiner Abreise vom „Haus Wiesenstein“ im niederschlesischen Agnetendorf im Riesengebirge nach Dresden schriftlich überlässt. In einem Güterwagon der deutschen Wehrmacht, der einem Lazarettzug angehängt ist, soll es zu Erich Ebermayer nach Schloss Kaibitz, „in der bayerischen Ostmark“, gebracht werden, „weil es der nächste sichere Platz“ ist. Die Rote Armee nähert sich bereits Oberschlesien.
Erich Ebermayer notiert: „[…] am 7. März 1945 rollten zwei LKW der Wehrmacht in den Hof meines Landhauses bei Bayreuth und brachten die Kisten des Gerhart Hauptmann Archivs aus dem Wiesenstein. Die Kisten, sorgsam aufbewahrt, wurden beim Einmarsch der Amerikaner am 19. April 1945 erbrochen [sic!] und nach Waffen durchsucht. Aber keines der vieltausend Blätter: Manuskripte, Entwürfe, Notizen, Tagebücher Gerhart Hauptmanns fehlt heute.“
Der Verbleib des Gerhart-Hauptmann-Archivs, einer immensen Sammlung von unveröffentlichten Manuskripten, Tagebüchern, Presseberichten und Briefen, war aber nicht von langer Dauer. Gerhart Hauptmanns jüngster Sohn Dr. Benvenuto Hauptmann (1900-1965), der in Oberhaselbach bei Passau das Kriegsende überstanden hat, lässt am 18. Dezember 1945 mit Autorisierung der US-Military Government Regensburg das gesamte Archiv abholen und den „Schatz vom Wiesenstein“ nach Garmisch-Partenkirchen in die Villa des ebenfalls mit Gerhart Hauptmann befreundeten Komponisten Richard Strauss bringen. Nach dortiger zeitweiliger Unterbringung lässt er es weiter in sein Privathaus nach Ronco sopra Ascona im Tessin (Schweiz) verfrachten. Bis in die 1960er-Jahre hinein war dadurch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Archiv unmöglich.
Und C. F. W. Behl, der evangelische Berliner Intellektuelle und spätere Münchner, notiert am 2. Juni 1945 sozialkritisch in seinem Berndorfer Provisorium: „Hat man das Idyll genügend genossen, so wird man sich in steigendem Maße der Primitivität dieser in allem sehr hinterwäldlerischen Oberpfalz bewußt, wo im Schatten der Kirchtürme Habsucht, kleinstädtischer Neid und kleinstädtische Heuchelei üppig gedeiht. Auch das Landvolk ist von einem primitiven Egoismus besessen […]. Ebermayer auf Schloß Kaibitz und Voigts sind für uns die einzigen Verbindungsbrücken zu unserer früheren Existenz. Hier wird in Gesprächen unsere Welt immer wieder gegenwärtig.“
***
Links: Grabstein für Erich Ebermayer und seinen Vater, 1979 von Erich Ebermayer-Freund Peer Baedeker im Schlossgarten von Kaibitz gesetzt. Mitte und rechts: Die Autorinnen und Autoren der 21. Weidener Literaturtage besuchen auf Initiative von Kulturamtsleiter Bernhard M. Baron Schloss Kaibitz am 6. Mai 2005. Fotos: Horst Scheiner © Bernhard M. Baron
In der nördlichen Oberpfalz geht nach Kriegsende 1945 das Leben weiter. Erich Ebermayer wird kurzfristig Bürgermeister von Kaibitz und vertritt als Rechtsanwalt beim Landgericht Weiden in den beginnenden „Entnazifizierungsprozessen“ NS-Prominente, wie Emmy Göring, Schauspielerin und Ehefrau des durch Selbstmord verstorbenen Hermann Göring, und Winifried Wagner, Leiterin der Bayreuther Festspiele. Zahlreiche Bücher von Ebermayer erscheinen in Neuauflage, aber auch neue Romane (Hubertus, 1946; Auferstanden, 1948) entstehen sowie beliebte Serien in deutschen Illustrierten. Seine Popularität erreicht mit den Filmdrehbüchern für Canaris (1954 mit O. E. Hasse) und Die Mädels vom Immenhof (1956 mit Heidi Brühl) nochmals einen Höhepunkt. 1966 erscheint sein Tagebuch … und morgen die ganze Welt. Erinnerungen an Deutschlands dunkle Zeit.
Den Rest seines Lebens verbringt Ebermayer in seinem italienischen Landhaus „Casa Ebermayer“ in Terracina/Latina bei Rom. Seine Urne wird im Schlosspark von Kaibitz beigesetzt. 1979 lässt Peer Baedeker dort den Grabstein zur Erinnerung an den „Gerhart-Hauptmann-Freund“ errichten. Das denkmalgeschützte Schloss befindet sich heute in Privatbesitz.
Es wäre schön und sinnvoll, zweckmäßig und angebracht, „wenn der literarische Nachlass Erich Ebermayers neue Aufmerksamkeit“ erfahren würde, wie es der Münchner Literaturwissenschaftler Dr. Dirk Heißerer in seinem Ebermayer-Lesebuch (2005) anregt. Auch die Lokalität des markanten ehemaligen Wasser- und Hammerschlosses Kaibitz, unweit des sakral ausstrahlenden Klosters Speinshart gelegen, das einst Schutz für das markante Gerhart-Hauptmann-Archiv war und heute in einem Dornröschenschlaf versunken ist, bietet sich als reizvolle literarische Begegnungs- und Gedenkstätte an.
Baron, Bernhard M. (2024): Schloss Kaibitz und Erich Ebermayer. Wie das Schloss Kaibitz 1945 mit der Rettung des Gerhart-Hauptmann-Archivs in den Blickpunkt der deutschen Literatur gelangte. In: OBERPFÄLZER HEIMATSPIEGEL 2025, hg. von Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl, Speinshart, S. 73-77.
Behl, C. F. W. (1961): Aufsätze, Briefe, Tagebuchnotizen. Autobiographisches und Biographisches zu Gerhart Hauptmann, hg. von Klaus Hildebrandt (Publikation der Stiftung Schlesien, SILESIA-Folge 28), München S. 81f., 105-112.
Ders. (2005): Das Ende des deutschen Machtkrampfs (Sonderseite). In: DIE ZEIT Nr. 16, 14. April, S. 51.
Der Fall Ebermayer (1945). In: Wiener Kurier. Kunst und Künstler, 26. November, S. 4.
Ebermayer, Erich (2005): „Eh‘ ich’s vergesse…“. Erinnerungen an Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Klaus Mann, Gustav Gründgens, Emil Jannings und Stefan Zweig, hg. und mit einem Vorwort von Dirk Heißerer, München.
Henning, Peter (2024): Zwischen Opportunismus und Opposition: Kulturschaffende im Nationalsozialismus am Beispiel Erich Ebermayer (Forum historische Forschung: Moderne Welt), Stuttgart. (Diss.)
Leinisch, Elisabeth (2003): Erich Ebermayer auf Schloss Kaibitz. In: BR (Fernsehen, Reihe: „Ostbayern heute“), 19. Juni.
Muggenthaler, Thomas (2003): Die Mädels vom Immenhof und ihr vergessener Autor. In: BR (Hörfunk), 13. Juli.
Pleschinski, Hans (2018): Haus Wiesenstein. Roman, München.
Schön, Robert (2022): Ebermayer – und was es noch zu sagen gibt. In: Kemnather Heimatbote Bd. 42, S. 12-20.
Schwarzmaier, Alfred (2023): Die Hauptmanns und Martel. Das Leben der Margarete Heumader (Reihe „Gerhart Hauptmann und die Freunde“), dt.-poln. Ausgabe, Tiefenbach – Jelenia Gora.
Spruchkammerakt „Erich Ebermayer“. In: Spruchkammer Kemnath E 30, Staatsarchiv Amberg.
Externe Links:Schloss Kaibitz und Erich Ebermayer

Wie das Schloss Kaibitz 1945 mit der Rettung des Gerhart-Hauptmann-Archivs durch den Schriftsteller und Drehbuchautor Erich Ebermayer in den Blickpunkt der deutschen Literatur gelangte. Ein Beitrag von Bernhard M. Baron.
*
Erich Ebermayer (1900-1970), als Sohn eines Oberreichsanwalts in Leipzig geboren, Jurist, Schriftsteller, Theaterdichter und erfolgreicher UFA-Drehbuchautor, genießt in den 1920er- und 1930er-Jahren als Flaneur den Lebensstil eines wohlhabenden Intellektuellen, der zu seinem Freundeskreis Stefan Zweig, Emil Jannings, Gerhart Hauptmann, Gustaf Gründgens, Klaus und Thomas Mann sowie Zarah Leander zählt. Er hält feudal Hof, reist gerne ins Ausland und bleibt in Deutschland, obwohl er „in völkischen Kreisen“ als „Systemdichter“ und „Judenfreund“ gilt. Durch seine bekannt gewordene Homosexualität sucht der in Berlin lebende Erich Ebermayer eine Villa in der Provinz und erwirbt so im Sommer 1939 das kleine historische Wasser- und Hammerschloss Kaibitz am Fuße des Vulkans Rauer Kulm – zu dessen Refugium Ökonomiegebäude und eine Brauerei gehören – unweit der Stadt Kemnath im heutigen Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz.
Schon bald entsteht um sein Oberpfälzer Gut, wo illustre Feste mit Autoren, Künstlern und UFA-Schauspielern gefeiert werden, in Berndorf, Oberndorf, im Landsassengut Unterbruck und Schloss Wolframshof eine stattliche Künstlerkolonie: Carl Friedrich Wilhelm Behl (1889-1968), engster Vertrauter von Gerhart Hauptmann; Peer (eigentlich Ernst-Max) Baedeker (1912-1999), Mitarbeiter und Lebenspartner von Erich Ebermayer; der Literaturwissenschaftler Felix A. Voigt (1892-1962); die baltisch-deutsche Schriftstellerin Gertrud Freiin von den Brincken (1892-1982) sowie die Presse- und Theaterzeichnerin Christa von der Schulenburg (1908-1993) siedeln sich hier an.
Die Vorzeichen des Zweiten Weltkrieges verzeichnet auch das Tagebuch Erich Ebermayers auf seinem Oberpfälzer Wasserschloss:
Kaibitz, 29. August 1939: „Seit drei Tagen, das erfahre ich erst jetzt, wunderte mich nur über die angenehme Ruhe in der Luft, ist ‚Luftsperre‘. Auf dem nahen Militär-Flugplatz Kirchenlaibach steigt kein Flugzeug mehr auf. Einer der wenigen Vorteile dieser großen Zeit. […]“
Kaibitz, 1. September 1939 – Mitternacht: „[…] Die erste Nacht der Verdunkelung! Wieviele werden folgen? Wie ist die geliebte Landschaft auch in dieser ersten Kriegsnacht groß und weit und still! Nichts regt sich in den Lüften.“
Der Grandseigneur und Bonvivant lässt sich vom kommenden Kriegsgeschehen nicht ablenken. Er schreibt und dreht weiter Filme. Jahre später wird er diese Zeit als Teil seiner „Inneren Emigration“ bezeichnen.
**
Die eigentliche Rettung des Gerhart-Hauptmann-Archivs, des sog. „Schatzes vom Wiesenstein“, ist sicherlich C. F. W. Behl zu verdanken, welches ihm Gerhart Hauptmann (1862-1946) am 5. Februar 1945 vor seiner Abreise vom „Haus Wiesenstein“ im niederschlesischen Agnetendorf im Riesengebirge nach Dresden schriftlich überlässt. In einem Güterwagon der deutschen Wehrmacht, der einem Lazarettzug angehängt ist, soll es zu Erich Ebermayer nach Schloss Kaibitz, „in der bayerischen Ostmark“, gebracht werden, „weil es der nächste sichere Platz“ ist. Die Rote Armee nähert sich bereits Oberschlesien.
Erich Ebermayer notiert: „[…] am 7. März 1945 rollten zwei LKW der Wehrmacht in den Hof meines Landhauses bei Bayreuth und brachten die Kisten des Gerhart Hauptmann Archivs aus dem Wiesenstein. Die Kisten, sorgsam aufbewahrt, wurden beim Einmarsch der Amerikaner am 19. April 1945 erbrochen [sic!] und nach Waffen durchsucht. Aber keines der vieltausend Blätter: Manuskripte, Entwürfe, Notizen, Tagebücher Gerhart Hauptmanns fehlt heute.“
Der Verbleib des Gerhart-Hauptmann-Archivs, einer immensen Sammlung von unveröffentlichten Manuskripten, Tagebüchern, Presseberichten und Briefen, war aber nicht von langer Dauer. Gerhart Hauptmanns jüngster Sohn Dr. Benvenuto Hauptmann (1900-1965), der in Oberhaselbach bei Passau das Kriegsende überstanden hat, lässt am 18. Dezember 1945 mit Autorisierung der US-Military Government Regensburg das gesamte Archiv abholen und den „Schatz vom Wiesenstein“ nach Garmisch-Partenkirchen in die Villa des ebenfalls mit Gerhart Hauptmann befreundeten Komponisten Richard Strauss bringen. Nach dortiger zeitweiliger Unterbringung lässt er es weiter in sein Privathaus nach Ronco sopra Ascona im Tessin (Schweiz) verfrachten. Bis in die 1960er-Jahre hinein war dadurch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Archiv unmöglich.
Und C. F. W. Behl, der evangelische Berliner Intellektuelle und spätere Münchner, notiert am 2. Juni 1945 sozialkritisch in seinem Berndorfer Provisorium: „Hat man das Idyll genügend genossen, so wird man sich in steigendem Maße der Primitivität dieser in allem sehr hinterwäldlerischen Oberpfalz bewußt, wo im Schatten der Kirchtürme Habsucht, kleinstädtischer Neid und kleinstädtische Heuchelei üppig gedeiht. Auch das Landvolk ist von einem primitiven Egoismus besessen […]. Ebermayer auf Schloß Kaibitz und Voigts sind für uns die einzigen Verbindungsbrücken zu unserer früheren Existenz. Hier wird in Gesprächen unsere Welt immer wieder gegenwärtig.“
***
Links: Grabstein für Erich Ebermayer und seinen Vater, 1979 von Erich Ebermayer-Freund Peer Baedeker im Schlossgarten von Kaibitz gesetzt. Mitte und rechts: Die Autorinnen und Autoren der 21. Weidener Literaturtage besuchen auf Initiative von Kulturamtsleiter Bernhard M. Baron Schloss Kaibitz am 6. Mai 2005. Fotos: Horst Scheiner © Bernhard M. Baron
In der nördlichen Oberpfalz geht nach Kriegsende 1945 das Leben weiter. Erich Ebermayer wird kurzfristig Bürgermeister von Kaibitz und vertritt als Rechtsanwalt beim Landgericht Weiden in den beginnenden „Entnazifizierungsprozessen“ NS-Prominente, wie Emmy Göring, Schauspielerin und Ehefrau des durch Selbstmord verstorbenen Hermann Göring, und Winifried Wagner, Leiterin der Bayreuther Festspiele. Zahlreiche Bücher von Ebermayer erscheinen in Neuauflage, aber auch neue Romane (Hubertus, 1946; Auferstanden, 1948) entstehen sowie beliebte Serien in deutschen Illustrierten. Seine Popularität erreicht mit den Filmdrehbüchern für Canaris (1954 mit O. E. Hasse) und Die Mädels vom Immenhof (1956 mit Heidi Brühl) nochmals einen Höhepunkt. 1966 erscheint sein Tagebuch … und morgen die ganze Welt. Erinnerungen an Deutschlands dunkle Zeit.
Den Rest seines Lebens verbringt Ebermayer in seinem italienischen Landhaus „Casa Ebermayer“ in Terracina/Latina bei Rom. Seine Urne wird im Schlosspark von Kaibitz beigesetzt. 1979 lässt Peer Baedeker dort den Grabstein zur Erinnerung an den „Gerhart-Hauptmann-Freund“ errichten. Das denkmalgeschützte Schloss befindet sich heute in Privatbesitz.
Es wäre schön und sinnvoll, zweckmäßig und angebracht, „wenn der literarische Nachlass Erich Ebermayers neue Aufmerksamkeit“ erfahren würde, wie es der Münchner Literaturwissenschaftler Dr. Dirk Heißerer in seinem Ebermayer-Lesebuch (2005) anregt. Auch die Lokalität des markanten ehemaligen Wasser- und Hammerschlosses Kaibitz, unweit des sakral ausstrahlenden Klosters Speinshart gelegen, das einst Schutz für das markante Gerhart-Hauptmann-Archiv war und heute in einem Dornröschenschlaf versunken ist, bietet sich als reizvolle literarische Begegnungs- und Gedenkstätte an.
Baron, Bernhard M. (2024): Schloss Kaibitz und Erich Ebermayer. Wie das Schloss Kaibitz 1945 mit der Rettung des Gerhart-Hauptmann-Archivs in den Blickpunkt der deutschen Literatur gelangte. In: OBERPFÄLZER HEIMATSPIEGEL 2025, hg. von Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl, Speinshart, S. 73-77.
Behl, C. F. W. (1961): Aufsätze, Briefe, Tagebuchnotizen. Autobiographisches und Biographisches zu Gerhart Hauptmann, hg. von Klaus Hildebrandt (Publikation der Stiftung Schlesien, SILESIA-Folge 28), München S. 81f., 105-112.
Ders. (2005): Das Ende des deutschen Machtkrampfs (Sonderseite). In: DIE ZEIT Nr. 16, 14. April, S. 51.
Der Fall Ebermayer (1945). In: Wiener Kurier. Kunst und Künstler, 26. November, S. 4.
Ebermayer, Erich (2005): „Eh‘ ich’s vergesse…“. Erinnerungen an Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Klaus Mann, Gustav Gründgens, Emil Jannings und Stefan Zweig, hg. und mit einem Vorwort von Dirk Heißerer, München.
Henning, Peter (2024): Zwischen Opportunismus und Opposition: Kulturschaffende im Nationalsozialismus am Beispiel Erich Ebermayer (Forum historische Forschung: Moderne Welt), Stuttgart. (Diss.)
Leinisch, Elisabeth (2003): Erich Ebermayer auf Schloss Kaibitz. In: BR (Fernsehen, Reihe: „Ostbayern heute“), 19. Juni.
Muggenthaler, Thomas (2003): Die Mädels vom Immenhof und ihr vergessener Autor. In: BR (Hörfunk), 13. Juli.
Pleschinski, Hans (2018): Haus Wiesenstein. Roman, München.
Schön, Robert (2022): Ebermayer – und was es noch zu sagen gibt. In: Kemnather Heimatbote Bd. 42, S. 12-20.
Schwarzmaier, Alfred (2023): Die Hauptmanns und Martel. Das Leben der Margarete Heumader (Reihe „Gerhart Hauptmann und die Freunde“), dt.-poln. Ausgabe, Tiefenbach – Jelenia Gora.
Spruchkammerakt „Erich Ebermayer“. In: Spruchkammer Kemnath E 30, Staatsarchiv Amberg.