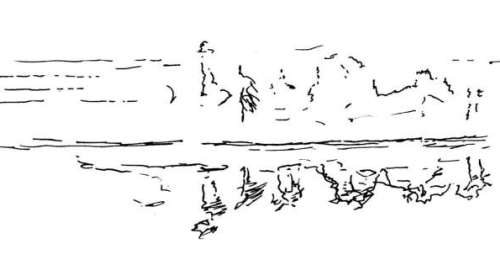Neue Gedichtbände vorgestellt: Stefan Wirners „Die Kunst zu fallen“ und Pauline Fügs „nach der illusion“
Der in Weiden geborene Stefan Wirner lebt seit 1990 als Journalist und Autor in Berlin. Seit Januar 2012 arbeitet er als Redaktionsleiter der „drehscheibe“, des Magazins für Lokaljournalisten der Bundeszentrale für politische Bildung. Wirner schreibt Glossen für verschiedene Zeitungen und Artikel, u.a. für Amnesty International. Als Autor von drei „cut-up-Romanen“ (Verbrecher Verlag, Berlin) und Gedichten (Love to Go, 2011) ist Stefan Wirner belletristisch hervorgetreten. Als Lyriker sieht er sich in der Tradition des französischen surrealistischen Dichters René Char. 2021 ist sein neuer Lyrikband Die Kunst zu fallen (edition offenes feld) erschienen.
Die in Fürth lebende Pauline Füg ist Diplom-Psychologin und arbeitet als Bühnenpoetin, Autorin, Creative Coach und Moderatorin. Mit „demenzPoesie“ entwickelte sie eine Therapie zur Gedächtnisrehabilitation von Menschen mit Demenz. Ihr kreatives Wissen gibt sie in Schreibwerkstätten, Poetry Slam-Workshops sowie Coachings weiter. Sie moderiert den U20 Poetry Slam in Ingolstadt, Nürnberg, Fürth, Würzburg und Schweinfurt. Für ihr Schaffen wurde sie u.a. mit dem Kulturpreis Bayern (2011), dem Kulturförderpreis der Stadt Würzburg (2015) sowie dem Arbeitsstipendium des Freistaats Bayern (2020) ausgezeichnet. Im September 2021 ist ihr zweiter Lyrikband nach der illusion (Lektora Verlag) erschienen.
*
Die Kunst zu fallen – Der Titel von Stefan Wirners jüngst erschienenem Lyrikband ist Programm: Wie im Eingangsgedicht Sekundentakt bereits anklingt, lädt er den Leser ein, sich auf eine neue Gedankenwelt einzulassen: „Lass dich treiben / fall aus allen Wolken [...] Sag ab die Termine / widersteh dem Sekundentakt“ (Sekundentakt, S. 7). Sich an das Motto Carpe Diem anlehnend, mahnt das lyrische Ich den Leser vor dem Verbleichen der Zeit und fordert ihn auf, diese zu nutzen, denn „morgen ist der Tag verschwunden / und die Zukunft wird / zum Artefakt“ (ebenda).
Indem er gleich zu Beginn die menschliche Befangenheit innerhalb eines im „Sekundentakt“ geregelten Lebens aufzeigt, greift Wirner eine zentrale Problematik der modernen großstädtischen Gesellschaft auf: die Selbstentfremdung des Menschen und die damit einhergehende Sehnsucht nach der weiten Ferne. So lautet es in dem Gedicht Neufundland (S. 8):
Wollen wir uns zu neuen / Kontinenten durchschlagen? / Die alten sind müde / und verbraucht. Ihre Felder // tragen kaum noch Früchte / die Quellen sind versiegt / und die Wolken aus Asche / bringen keinen Regen // Wir folgen dem Weg hinaus / aus der Stadt, wir passieren die / Autobahn, auf deren Seitenstreifen / einst Schilfrohre blühten // Viele Berge, viele Meere / liegen vor uns. Doch wir sind / gerüstet: Kompass, Messer / Stift und Papier
Die in diesem Gedicht skizzierte Diskrepanz zwischen der ‚abgenutzten‘ Großstadt einerseits und der naturbelassenen Weite andererseits, bildet eines der primären Leitmotive dieses Gedichtbandes und findet neben Neufundland auch Eingang in die anderen Gedichte.
Mit seiner ablehnenden Beurteilung des Großstadtraums stellt Wirner sich in die Traditionslinie vieler Soziologen wie u.a. Georg Simmel oder Richard Sennett, die den Stadtraum bereits vor Jahren als sachlichen und gefühlskalten Ort abgetan haben. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt auch Wirner in seinem Werk und es darf wohl niemanden verwundern, dass die Stadt fast ausschließlich in der Nacht beschrieben wird. Wirner stilisiert die Großstadt damit in erster Linie als dunklen und zugleich unheimlichen Raum, dem jegliches Idyllisch-Naturhafte abgesprochen wird: „[K]ein Tier lebt / mehr in dieser Stadt“ (Chrom, S. 28). Und anstelle der Jäger jagen nur noch „Motorräder [...] durch / die Stadt“ (ebenda). Auch die städtischen Wohnungen zeugen von wenig Wärme und Geborgenheit; sie sind klein, unpersönlich und sanierbedürftig, wie im Gedicht Interieur illustriert wird: „Müll auf der Treppe / verborgene Räume / ein nasser Teppich / etwas eingerollt darin / ich fand mich nicht zurecht“ (Interieur, S. 43).
Eindrücklich ist jedoch vor allem die – besonders in den Gedichten Feiertag, Manchmal träumt mir oder Der zweite Raum – hergestellte Analogie der Großstadt zum Tod. Durch diese wird die Großstadt letztlich zu einem unheilvollen oder gar morbiden Raum erhoben, in dem die Straßen „gesäumt von grauen Häusern / wie Gesichter von Toten“ sind (Manchmal träumt mir, S. 44). Die dadurch evozierte düstere Grundstimmung durchzieht den ganzen Gedichtband und kann selbst durch die siebenteilige Assiniboine-Gedichtreihe, in der sich das lyrische Ich primär mit der Natur und ihren Schöpfungen auseinandersetzt, nicht durchbrochen werden. So konkludiert das lyrische Ich in Erde: „Die Erde schmeckt nicht mehr / mein Freund / kein Salz, kein Honig / kein Kraut, kein Wein // Sie zergeht nicht mehr / auf der Zunge / stecken bleibt sie im Hals / ersticken / ersticken werden wir an ihr / so sehr wir auch / schlucken / und / schlucken“ (Erde, S. 18). Die Geminatio der Wörter „ersticken“ und „schlucken“ veranschaulicht auf formaler wie inhaltlicher Ebene, wie sehr der Mensch sich trotz jeglicher Bemühungen von der Natur und ihren Ressourcen entfernt hat, und illustriert darüber hinaus sein Unvermögen, zu dieser zurückzufinden.
Einziger Lichtpunkt inmitten dieser vorherrschenden Stimmung des Bandes bildet Auf dem Weg nach Buckow, ein Gedicht, das nicht nur den Bezug zu Bertolt Brecht und dessen Gedichtzyklus Buckower Elegien herstellt, sondern auch eine besondere Art der Antiklimax wiedergibt: Mit jedem Vers weicht das Städtische reduktionistisch aus dem Bild – anstelle von „Supermärkte[n] und Tankstellen“, „Spielhöllen und Möbelparadiese[n]“ zieren bald nur noch „[e]ine Kathedrale aus Bäumen“, ein „Specht und ein Reh“, den Weg nach Buckow. Letztlich werden aus „Bertolt und Helene“ nur noch „Du und ich“, zwei Menschen, die im naturbelassenen Buckow zu sich selber zurückfinden möchten.
Stefan Wirner: Die Kunst zu fallen (c) edition offenes feld
Ungeahntes Aufeinandertreffen
„Die Gedichte stehen allein / Worte, Strophen / ohne Reim, Waisenkinder / geworfen in die Zeit“ (Ungeahntes Aufeinandertreffen, S. 49). So lauten die ersten Verse von Ungeahntes Aufeinandertreffen. Tatsächlich können diese auch auf Wirners eigenen Lyrikband bezogen werden, insofern als jedes der fünfundsechzig Gedichte als Einzelwerk konzipiert ist. Nichtsdestoweniger lässt sich durch eine kontinuierliche Lektüre der Gedichte unschwer erkennen, dass sich die Werke zu einem Gesamtbild zusammenfügen, in dem letztlich der Großstadtmensch als Leidtragender dargestellt wird. Auf poetische und zugleich sachliche Art und Weise zeigt Wirner, dass es den Menschen nicht möglich ist, die aus der modernen Gesellschaft entstandenen Konflikte zu überwinden. Sie haben nicht nur den zwischenmenschlichen Kontakt zu ihrem Umfeld verloren – „Wir sehen den Wellen zu, kein Wort fällt zwischen uns / Etwas ist gestrandet zwischen dir und mir / Keiner weiß, wann es war“ (Am Strand, S. 9) – auch haben sie an Lebenskraft eingebüßt. Am Strand liegen sie wie „aufgebrochene Muscheln“; im Gedicht Theben sind selbst archäologische Restbestände mit mehr Leben erfüllt als die noch lebenden Menschen: „Die Dinge sind beseelter als die / Wesen, sie führen ein eigenwilliges Leben // Wir aber haben uns an den Bildern infiziert / der Untergang von Theben“ (Theben, S. 13).
Glanzpunkt des Bandes sind besonders die Gedichte, die als Kindheitserinnerungen oder lyrische Traumerzählungen ausgelegt sind. Zum einen verleihen diese Wirners Gedichtband eine intime Note, zum anderen stellen sie auch die menschliche Verwundbarkeit in den Vordergrund. Vor allem die Selbstentfremdung des lyrischen Ichs bzw. des modernen Menschen tritt in diesen Ausschnitten am deutlichsten zutage: „Ich war eingezwängt in ein Leben / das nicht das meine war // [...] Schritt auf Schritt, ich kam nicht / vom Fleck, inmitten einer neuen Zeit / im Hemd eines anderen“ (Falsches Hemd, S. 45).
Es sind diese einfachen Metonymien und zum Teil vielleicht auch kryptischen Formulierungen, die Wirners poetisches Werk in seinem Kern ausmachen. Besonders in Anbetracht der persönlichen und anderen, den Alltag schildernden Gedichte, wie beispielsweise Plagiat, Nachtfalter oder Giraffe, stellt sich die Frage, ob dieser lyrische Band nicht vielleicht auch einen therapeutischen Selbstzweck für den Dichter erfüllt. Nichtsdestoweniger trifft Wirner den Nerv einer vieldiskutierten Thematik; es ist wohl kein Geheimnis, dass sich der moderne Mensch zusehends verändert, sich einem rastlosen Leben hingibt und stetig vom sozialen Umfeld distanziert. Eben genau deshalb ist Die Kunst zu fallen umso lesenswerter: Übt das lyrische Ich in den Gedichten zuweilen Kritik aus, so offenbart sich in diesen eine Wahrheit, die den Leser zum Nachdenken auffordert und ihn für einige Momente sein – im „Sekundentakt“ – geregeltes Leben vergessen lässt.
**
Pauline Füg: nach der illusion (c) Lektora
nach der illusion
Stimmt Pauline Fügs Lyrikzyklus in zwei Teilen nach der illusion mit Gegenstand und Ziel Wirners überein, so unterscheidet der Band sich hinsichtlich seiner formalen Umsetzung. Mittels Verse wie „eine optische täuschung / aus porzellan bin ich“ (bewegungsgleichungen und randbedingungen, S. 10) oder „bin ich nur ein echo / von etwas das ich früher gerufen habe / ich glaube wir waren nicht da / noch nicht einmal digital“ (veränderungen von gehirnwellen; deine, S. 11) thematisiert das lyrische Ich hier die Entfremdung von sich selbst sowie von den Mitmenschen. Dabei betont es vor allem den Kommunikationsverlust, der zwischen sich und seinem Gegenüber entstanden ist: „ich fragmentiere / sortiere meine ungeborenen / sätze in unsichtbare / ordner schubladen des cortex / und du fragst nichts“ (in einer verschränkten gleichzeitigkeit, S. 7). Doch was bleibt dem Einzelnen, wenn inmitten einer zermürbenden Gesellschaft jegliche Zwischenmenschlichkeit verloren geht? Wenn sich Individuen so weit voneinander distanziert haben, dass ihnen plötzlich die Antwort auf die Frage „wie erkennt man ein gefühl“ (wir schliefen die letzten jahre unter dem mond, S. 13) fehlt? In Fügs Gedichten wird angedeutet: Was zuletzt bleibt, sind das zurückbleibende Verlangen nach einer wiederkehrenden Sinnlichkeit –
ich möchte dich atmen sehen / eigentlich ist das alles / was ich für die nächsten jahre möchte / und ab und zu so nah an deinem mund liegen / dass ich sicher bin dass alles funktioniert
– sowie der Versuch, diese für alle Ewigkeit festzuhalten:
dein wort im zuge der wahrheit: verschwendung / es bleibt uns wenig weiter übrig / meine hände / deine hände / sonst nichts / du wirst schriftlich festgehalten / dann können wir gehen
(wir schliefen die letzten jahre unter dem mond, S. 12; icd-101, S. 14).
Obgleich die thematischen Schwerpunkte einen spannenden Beitrag zur Diskussion rund um die Selbstwahrnehmung innerhalb einer modernen Gesellschaft liefern, so sind es vor allem die stilistischen und formalen Ausgestaltungen, die Fügs lyrisches Werk von anderen Gedichtbänden abheben lässt. Nicht nur spiegeln ihre Gedichte ihre Affinität zur ‚Spoken Poetry‘ wider, auch verkörpern sie einen lyrischen Raum, in dem das lyrische Ich mit der Wahrnehmung des Einzelnen spielt. Der Titel des vorliegenden Lyrikbands verspricht dem Leser eine ‚Illusion‘ – sein Inhalt und vor allem seine Form liefern sie ihm. Diesbezüglich sticht bereits auf den ersten Blick der konsequente Verzicht auf Interpunktion wie auch Groß- und Kleinschreibung heraus. Durch diese Tilgung einerseits und die Enjambements und kryptischen Formulierungen andererseits gewinnen die Gedichte an Tiefe und semantischer Doppelbödigkeit. Indem jedoch die zahlreichen Bedeutungszusammenhänge ineinanderfließen, entsteht für den Leser ein für Verwirrung sorgendes, illusionäres bzw. dubioses Moment, bei welchem er sich gelegentlich in Deutungsversuchen verliert.
Insgesamt erweisen sich die Gedichte als einzelne Kunstwerke, in denen Fügs sehr gewandter und ungewöhnlicher Umgang mit Sprache zum Ausdruck kommt – diesen Ausdruck richtig zu deuten bzw. zu entschlüsseln, stellt in manchen Fällen eine Herausforderung dar und erfordert eine aufmerksame Lektüre. Nichtsdestoweniger scheint eben genau dies Fügs Wirkungsabsicht zu sein, die sie mit ihrem Werk zu erbringen versucht: den Leser zu ermuntern, kreativ zu sein, über die Bedeutung der einzelnen Verse hinauszudenken, die Illusionen zu dechiffrieren und eigene Überlegungen anzustellen.
Stefan Wirner: Die Kunst zu fallen. edition offenes feld, Dortmund 2021, 76 Seiten, Hardcover mit SU, ISBN 9783754341599, € 16,50
Pauline Füg: nach der illusion. Lektora, Paderborn 2021, 98 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-95461-200-0, € 13,90
Neue Gedichtbände vorgestellt: Stefan Wirners „Die Kunst zu fallen“ und Pauline Fügs „nach der illusion“
Der in Weiden geborene Stefan Wirner lebt seit 1990 als Journalist und Autor in Berlin. Seit Januar 2012 arbeitet er als Redaktionsleiter der „drehscheibe“, des Magazins für Lokaljournalisten der Bundeszentrale für politische Bildung. Wirner schreibt Glossen für verschiedene Zeitungen und Artikel, u.a. für Amnesty International. Als Autor von drei „cut-up-Romanen“ (Verbrecher Verlag, Berlin) und Gedichten (Love to Go, 2011) ist Stefan Wirner belletristisch hervorgetreten. Als Lyriker sieht er sich in der Tradition des französischen surrealistischen Dichters René Char. 2021 ist sein neuer Lyrikband Die Kunst zu fallen (edition offenes feld) erschienen.
Die in Fürth lebende Pauline Füg ist Diplom-Psychologin und arbeitet als Bühnenpoetin, Autorin, Creative Coach und Moderatorin. Mit „demenzPoesie“ entwickelte sie eine Therapie zur Gedächtnisrehabilitation von Menschen mit Demenz. Ihr kreatives Wissen gibt sie in Schreibwerkstätten, Poetry Slam-Workshops sowie Coachings weiter. Sie moderiert den U20 Poetry Slam in Ingolstadt, Nürnberg, Fürth, Würzburg und Schweinfurt. Für ihr Schaffen wurde sie u.a. mit dem Kulturpreis Bayern (2011), dem Kulturförderpreis der Stadt Würzburg (2015) sowie dem Arbeitsstipendium des Freistaats Bayern (2020) ausgezeichnet. Im September 2021 ist ihr zweiter Lyrikband nach der illusion (Lektora Verlag) erschienen.
*
Die Kunst zu fallen – Der Titel von Stefan Wirners jüngst erschienenem Lyrikband ist Programm: Wie im Eingangsgedicht Sekundentakt bereits anklingt, lädt er den Leser ein, sich auf eine neue Gedankenwelt einzulassen: „Lass dich treiben / fall aus allen Wolken [...] Sag ab die Termine / widersteh dem Sekundentakt“ (Sekundentakt, S. 7). Sich an das Motto Carpe Diem anlehnend, mahnt das lyrische Ich den Leser vor dem Verbleichen der Zeit und fordert ihn auf, diese zu nutzen, denn „morgen ist der Tag verschwunden / und die Zukunft wird / zum Artefakt“ (ebenda).
Indem er gleich zu Beginn die menschliche Befangenheit innerhalb eines im „Sekundentakt“ geregelten Lebens aufzeigt, greift Wirner eine zentrale Problematik der modernen großstädtischen Gesellschaft auf: die Selbstentfremdung des Menschen und die damit einhergehende Sehnsucht nach der weiten Ferne. So lautet es in dem Gedicht Neufundland (S. 8):
Wollen wir uns zu neuen / Kontinenten durchschlagen? / Die alten sind müde / und verbraucht. Ihre Felder // tragen kaum noch Früchte / die Quellen sind versiegt / und die Wolken aus Asche / bringen keinen Regen // Wir folgen dem Weg hinaus / aus der Stadt, wir passieren die / Autobahn, auf deren Seitenstreifen / einst Schilfrohre blühten // Viele Berge, viele Meere / liegen vor uns. Doch wir sind / gerüstet: Kompass, Messer / Stift und Papier
Die in diesem Gedicht skizzierte Diskrepanz zwischen der ‚abgenutzten‘ Großstadt einerseits und der naturbelassenen Weite andererseits, bildet eines der primären Leitmotive dieses Gedichtbandes und findet neben Neufundland auch Eingang in die anderen Gedichte.
Mit seiner ablehnenden Beurteilung des Großstadtraums stellt Wirner sich in die Traditionslinie vieler Soziologen wie u.a. Georg Simmel oder Richard Sennett, die den Stadtraum bereits vor Jahren als sachlichen und gefühlskalten Ort abgetan haben. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt auch Wirner in seinem Werk und es darf wohl niemanden verwundern, dass die Stadt fast ausschließlich in der Nacht beschrieben wird. Wirner stilisiert die Großstadt damit in erster Linie als dunklen und zugleich unheimlichen Raum, dem jegliches Idyllisch-Naturhafte abgesprochen wird: „[K]ein Tier lebt / mehr in dieser Stadt“ (Chrom, S. 28). Und anstelle der Jäger jagen nur noch „Motorräder [...] durch / die Stadt“ (ebenda). Auch die städtischen Wohnungen zeugen von wenig Wärme und Geborgenheit; sie sind klein, unpersönlich und sanierbedürftig, wie im Gedicht Interieur illustriert wird: „Müll auf der Treppe / verborgene Räume / ein nasser Teppich / etwas eingerollt darin / ich fand mich nicht zurecht“ (Interieur, S. 43).
Eindrücklich ist jedoch vor allem die – besonders in den Gedichten Feiertag, Manchmal träumt mir oder Der zweite Raum – hergestellte Analogie der Großstadt zum Tod. Durch diese wird die Großstadt letztlich zu einem unheilvollen oder gar morbiden Raum erhoben, in dem die Straßen „gesäumt von grauen Häusern / wie Gesichter von Toten“ sind (Manchmal träumt mir, S. 44). Die dadurch evozierte düstere Grundstimmung durchzieht den ganzen Gedichtband und kann selbst durch die siebenteilige Assiniboine-Gedichtreihe, in der sich das lyrische Ich primär mit der Natur und ihren Schöpfungen auseinandersetzt, nicht durchbrochen werden. So konkludiert das lyrische Ich in Erde: „Die Erde schmeckt nicht mehr / mein Freund / kein Salz, kein Honig / kein Kraut, kein Wein // Sie zergeht nicht mehr / auf der Zunge / stecken bleibt sie im Hals / ersticken / ersticken werden wir an ihr / so sehr wir auch / schlucken / und / schlucken“ (Erde, S. 18). Die Geminatio der Wörter „ersticken“ und „schlucken“ veranschaulicht auf formaler wie inhaltlicher Ebene, wie sehr der Mensch sich trotz jeglicher Bemühungen von der Natur und ihren Ressourcen entfernt hat, und illustriert darüber hinaus sein Unvermögen, zu dieser zurückzufinden.
Einziger Lichtpunkt inmitten dieser vorherrschenden Stimmung des Bandes bildet Auf dem Weg nach Buckow, ein Gedicht, das nicht nur den Bezug zu Bertolt Brecht und dessen Gedichtzyklus Buckower Elegien herstellt, sondern auch eine besondere Art der Antiklimax wiedergibt: Mit jedem Vers weicht das Städtische reduktionistisch aus dem Bild – anstelle von „Supermärkte[n] und Tankstellen“, „Spielhöllen und Möbelparadiese[n]“ zieren bald nur noch „[e]ine Kathedrale aus Bäumen“, ein „Specht und ein Reh“, den Weg nach Buckow. Letztlich werden aus „Bertolt und Helene“ nur noch „Du und ich“, zwei Menschen, die im naturbelassenen Buckow zu sich selber zurückfinden möchten.
Stefan Wirner: Die Kunst zu fallen (c) edition offenes feld
Ungeahntes Aufeinandertreffen
„Die Gedichte stehen allein / Worte, Strophen / ohne Reim, Waisenkinder / geworfen in die Zeit“ (Ungeahntes Aufeinandertreffen, S. 49). So lauten die ersten Verse von Ungeahntes Aufeinandertreffen. Tatsächlich können diese auch auf Wirners eigenen Lyrikband bezogen werden, insofern als jedes der fünfundsechzig Gedichte als Einzelwerk konzipiert ist. Nichtsdestoweniger lässt sich durch eine kontinuierliche Lektüre der Gedichte unschwer erkennen, dass sich die Werke zu einem Gesamtbild zusammenfügen, in dem letztlich der Großstadtmensch als Leidtragender dargestellt wird. Auf poetische und zugleich sachliche Art und Weise zeigt Wirner, dass es den Menschen nicht möglich ist, die aus der modernen Gesellschaft entstandenen Konflikte zu überwinden. Sie haben nicht nur den zwischenmenschlichen Kontakt zu ihrem Umfeld verloren – „Wir sehen den Wellen zu, kein Wort fällt zwischen uns / Etwas ist gestrandet zwischen dir und mir / Keiner weiß, wann es war“ (Am Strand, S. 9) – auch haben sie an Lebenskraft eingebüßt. Am Strand liegen sie wie „aufgebrochene Muscheln“; im Gedicht Theben sind selbst archäologische Restbestände mit mehr Leben erfüllt als die noch lebenden Menschen: „Die Dinge sind beseelter als die / Wesen, sie führen ein eigenwilliges Leben // Wir aber haben uns an den Bildern infiziert / der Untergang von Theben“ (Theben, S. 13).
Glanzpunkt des Bandes sind besonders die Gedichte, die als Kindheitserinnerungen oder lyrische Traumerzählungen ausgelegt sind. Zum einen verleihen diese Wirners Gedichtband eine intime Note, zum anderen stellen sie auch die menschliche Verwundbarkeit in den Vordergrund. Vor allem die Selbstentfremdung des lyrischen Ichs bzw. des modernen Menschen tritt in diesen Ausschnitten am deutlichsten zutage: „Ich war eingezwängt in ein Leben / das nicht das meine war // [...] Schritt auf Schritt, ich kam nicht / vom Fleck, inmitten einer neuen Zeit / im Hemd eines anderen“ (Falsches Hemd, S. 45).
Es sind diese einfachen Metonymien und zum Teil vielleicht auch kryptischen Formulierungen, die Wirners poetisches Werk in seinem Kern ausmachen. Besonders in Anbetracht der persönlichen und anderen, den Alltag schildernden Gedichte, wie beispielsweise Plagiat, Nachtfalter oder Giraffe, stellt sich die Frage, ob dieser lyrische Band nicht vielleicht auch einen therapeutischen Selbstzweck für den Dichter erfüllt. Nichtsdestoweniger trifft Wirner den Nerv einer vieldiskutierten Thematik; es ist wohl kein Geheimnis, dass sich der moderne Mensch zusehends verändert, sich einem rastlosen Leben hingibt und stetig vom sozialen Umfeld distanziert. Eben genau deshalb ist Die Kunst zu fallen umso lesenswerter: Übt das lyrische Ich in den Gedichten zuweilen Kritik aus, so offenbart sich in diesen eine Wahrheit, die den Leser zum Nachdenken auffordert und ihn für einige Momente sein – im „Sekundentakt“ – geregeltes Leben vergessen lässt.
**
Pauline Füg: nach der illusion (c) Lektora
nach der illusion
Stimmt Pauline Fügs Lyrikzyklus in zwei Teilen nach der illusion mit Gegenstand und Ziel Wirners überein, so unterscheidet der Band sich hinsichtlich seiner formalen Umsetzung. Mittels Verse wie „eine optische täuschung / aus porzellan bin ich“ (bewegungsgleichungen und randbedingungen, S. 10) oder „bin ich nur ein echo / von etwas das ich früher gerufen habe / ich glaube wir waren nicht da / noch nicht einmal digital“ (veränderungen von gehirnwellen; deine, S. 11) thematisiert das lyrische Ich hier die Entfremdung von sich selbst sowie von den Mitmenschen. Dabei betont es vor allem den Kommunikationsverlust, der zwischen sich und seinem Gegenüber entstanden ist: „ich fragmentiere / sortiere meine ungeborenen / sätze in unsichtbare / ordner schubladen des cortex / und du fragst nichts“ (in einer verschränkten gleichzeitigkeit, S. 7). Doch was bleibt dem Einzelnen, wenn inmitten einer zermürbenden Gesellschaft jegliche Zwischenmenschlichkeit verloren geht? Wenn sich Individuen so weit voneinander distanziert haben, dass ihnen plötzlich die Antwort auf die Frage „wie erkennt man ein gefühl“ (wir schliefen die letzten jahre unter dem mond, S. 13) fehlt? In Fügs Gedichten wird angedeutet: Was zuletzt bleibt, sind das zurückbleibende Verlangen nach einer wiederkehrenden Sinnlichkeit –
ich möchte dich atmen sehen / eigentlich ist das alles / was ich für die nächsten jahre möchte / und ab und zu so nah an deinem mund liegen / dass ich sicher bin dass alles funktioniert
– sowie der Versuch, diese für alle Ewigkeit festzuhalten:
dein wort im zuge der wahrheit: verschwendung / es bleibt uns wenig weiter übrig / meine hände / deine hände / sonst nichts / du wirst schriftlich festgehalten / dann können wir gehen
(wir schliefen die letzten jahre unter dem mond, S. 12; icd-101, S. 14).
Obgleich die thematischen Schwerpunkte einen spannenden Beitrag zur Diskussion rund um die Selbstwahrnehmung innerhalb einer modernen Gesellschaft liefern, so sind es vor allem die stilistischen und formalen Ausgestaltungen, die Fügs lyrisches Werk von anderen Gedichtbänden abheben lässt. Nicht nur spiegeln ihre Gedichte ihre Affinität zur ‚Spoken Poetry‘ wider, auch verkörpern sie einen lyrischen Raum, in dem das lyrische Ich mit der Wahrnehmung des Einzelnen spielt. Der Titel des vorliegenden Lyrikbands verspricht dem Leser eine ‚Illusion‘ – sein Inhalt und vor allem seine Form liefern sie ihm. Diesbezüglich sticht bereits auf den ersten Blick der konsequente Verzicht auf Interpunktion wie auch Groß- und Kleinschreibung heraus. Durch diese Tilgung einerseits und die Enjambements und kryptischen Formulierungen andererseits gewinnen die Gedichte an Tiefe und semantischer Doppelbödigkeit. Indem jedoch die zahlreichen Bedeutungszusammenhänge ineinanderfließen, entsteht für den Leser ein für Verwirrung sorgendes, illusionäres bzw. dubioses Moment, bei welchem er sich gelegentlich in Deutungsversuchen verliert.
Insgesamt erweisen sich die Gedichte als einzelne Kunstwerke, in denen Fügs sehr gewandter und ungewöhnlicher Umgang mit Sprache zum Ausdruck kommt – diesen Ausdruck richtig zu deuten bzw. zu entschlüsseln, stellt in manchen Fällen eine Herausforderung dar und erfordert eine aufmerksame Lektüre. Nichtsdestoweniger scheint eben genau dies Fügs Wirkungsabsicht zu sein, die sie mit ihrem Werk zu erbringen versucht: den Leser zu ermuntern, kreativ zu sein, über die Bedeutung der einzelnen Verse hinauszudenken, die Illusionen zu dechiffrieren und eigene Überlegungen anzustellen.
Stefan Wirner: Die Kunst zu fallen. edition offenes feld, Dortmund 2021, 76 Seiten, Hardcover mit SU, ISBN 9783754341599, € 16,50
Pauline Füg: nach der illusion. Lektora, Paderborn 2021, 98 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-95461-200-0, € 13,90