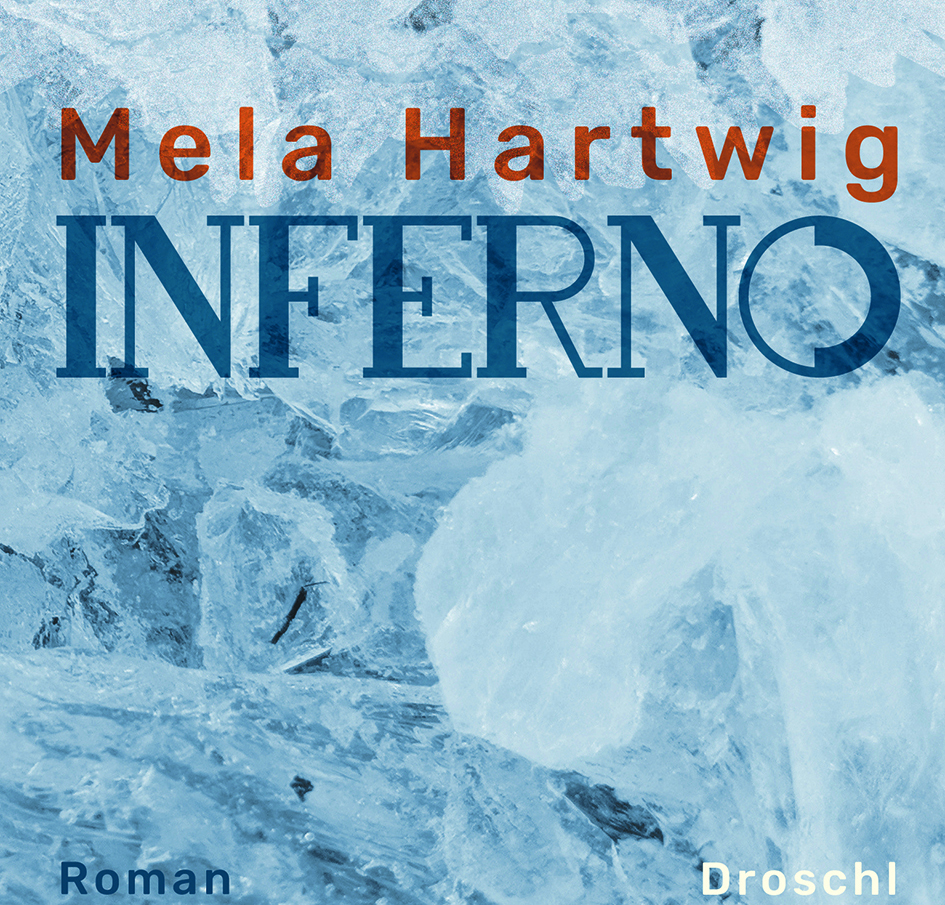Krafts Schattenkanon. Eine Ergänzung. Teil 38: Mela Hartwig Inferno (1948)
300 Jahre Literaturgeschichte hat sich der Münchner Schriftsteller und Publizist Thomas Kraft vorgenommen, um für das Literaturportal Bayern einige Schätze zu heben. Rund 40 unentdeckte Romane und Erzählungen deutschsprachiger Autorinnen und Autoren – darunter bekannte wie weniger bekannte – finden in dieser kurzweiligen Reihe (neu) ans Licht.
*
Mela Hartwig, 1893 als Tochter des Soziologen und Kulturphilosophen Theodor Herzl in Wien geboren, beginnt zunächst eine vielversprechende Karriere als Schauspielerin. Nach ihrer Heirat mit Robert Spira gibt sie jedoch ihre schauspielerische Laufbahn auf und zieht mit ihrem Mann nach Graz, wo dieser eine Rechtsanwaltskanzlei führt. In dieser Zeit wendet sich Hartwig dem Schreiben zu. 1927 wird ihre Novelle Das Verbrechen von Alfred Döblin bei einem Wettbewerb der Zeitschrift Die literarische Welt prämiert. Durch die Vermittlung Döblins und Stefan Zweigs kann Hartwig im darauffolgenden Jahr ihre Novellensammlung Ekstasen veröffentlichen. 1929 erscheint ihr Roman Das Weib ist ein Nichts und verursacht ebenso wie ihre Novellen einen Skandal. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und den darauffolgenden Repressionen nimmt Hartwigs Karriere ein abruptes Ende. Im Jahr 1931 sendet sie den Roman Bin ich ein überflüssiger Mensch? an den Zsolnay-Verlag in Wien, erhält jedoch im März 1933 die Absage mit den Worten: „Sie wissen, sehr verehrte gnädige Frau, dass das Weltbild des deutschen Lesepublikums und besonders der deutschen Frau heute ein anderes ist als die Lebensanschauung, die aus Ihrem Werke spricht.“
In dieser schwierigen Zeit widmet sich Hartwig der Malerei. Angesichts ihrer jüdischen Herkunft ist das Leben der Familie Spira nach dem „Anschluss“ Österreichs akut bedroht. Das Ehepaar Hartwig-Spira emigriert nach England, wo es rasch in den Freundeskreis von Virginia Woolf aufgenommen wird. 1948 kehren die Eheleute nach Graz zurück, um ihre 1938 beschlagnahmten Besitztümer zurückzufordern. Doch sie entscheiden sich, nicht länger in der steirischen Hauptstadt zu bleiben. Nach Abschluss der Rückstellungsverfahren verkaufen sie ihr Haus in Gösting sowie das Ferienhaus in Tauplitz und kehren endgültig nach London zurück, wo beide 1967 versterben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erzielt Hartwig auf dem Gebiet der Malerei, die sie unter dem Namen Mela Spira betreibt, einige Erfolge. Trotz des fortwährenden Schreibens und der Fertigstellung zahlreicher Manuskripte gelingt es ihr jedoch nicht, ein Buch zu veröffentlichen. Erst nach ihrem Tod findet ihr literarisches Werk die Anerkennung, die ihr zu Lebzeiten verwehrt bleibt. Mit einer Verspätung von siebzig Jahren wird der Roman Inferno veröffentlicht. Geschrieben wird er dagegen gleich nach dem Krieg (1946-48), als die Erinnerungen an die Wiener Exzesse der Nazi-Zeit noch frisch sind. „Ein expressives, fast filmisches Stück Literatur, das von den ersten Pogromen bis zum Kriegsende den Schattenriss einer Zeit liefert“, urteilt der Kritiker Paul Jandl.
Die Erzählung folgt der Kunststudentin Ursula und ihrer Familie inmitten einer Zeit des politischen Umbruchs. In einer Ära, die von der Verbreitung der Ideologie des Nationalsozialismus geprägt ist, entstehen neue Formen der Kunstverachtung, begleitet von einem Volk von Amokläufern, Denunzianten und fanatischen Nazis, die Pogrome inszenieren. Ursula setzt sich für die Flucht einer Freundin ein, die eine Beziehung zu einem jüdischen Mann unterhält, während ihr Geliebter im Widerstand gegen das Regime kämpft und eine Munitionsfabrik in die Luft jagt. Ihr Bruder, ein glühender Nazi, macht Karriere, zieht an die Front und fällt früh im Krieg. Der Vater bleibt in Passivität und Opportunismus gefangen, während die Mutter unter dem Leid der Familie leidet.
Hartwig schildert das Geschehen aus der Mitte des Unheils und setzt ein drastisches Vokabular ein, das die Atmosphäre der Bedrohung einfängt, die die Stadt durch die Fackelzüge in düstere Farben taucht. In dieser Atmosphäre des Fanatismus, der Angst und der Hysterie beschreibt Hartwig die kulturelle Zersetzung in präzisen Haltungen, Gesten und Mimik, und das alles aus der Sicht der jungen Frau Ursula. In einem Nachwort wird das Werk als eine Reflexion über das „innere Erleben des äußeren Schreckens“ bezeichnet. Die Gewalt bahnt sich ihren Weg, und die Ereignisse der Pogromnacht vom 9. November 1938 führen Ursula zur schmerzhaften Erkenntnis über die dramatische Schärfe der Situation. Der biblisch anmutende Satz „Der Tempel brennt“ erscheint mehrfach in Versalien, als Sinnbild für den um sich greifenden Abgrund, der Ursula von ihrer bisherigen Existenz trennt.
Ein Kommilitone begeht im Zeichensaal Selbstmord, um seiner Verhaftung zu entgehen. Ihr Geliebter erleidet im Caféhaus einen merkwürdigen Unfall, als ihm die Marmorplatte eines Tisches auf den Fuß fällt. Gegen den Künstler wird daraufhin wegen des Verdachts ermittelt, sich selbst verstümmelt zu haben, um sich der Einberufung zu entziehen. Denn inzwischen hat das Dritte Reich Polen überfallen. Ursulas Familie erlebt alle nur denkbaren Schicksalsschläge jener Zeit, eine „Flut aus Blut“. Einzig der Schrecken des Bombenkriegs bleibt ihr erspart: „Auch Ursula hörte den unheimlichen Warnungsruf der Sirene, aber nur zuweilen, denn noch wurde die Stadt, aus der steil der gotische Turm ihres geliebten, dem heiligen Stephan geweihten Domes emporstieg, geschont … Zwischen den Zeilen der Zeitungen brachen die Flammen hervor, die ferne Städte verheerten und verzehrten, die Worte, die das Radio hervorstieß, zerplatzten krachend, wie ferne Detonationen, und was Zeitungen und Radio verschwiegen, spiegelte sich in den aschgrauen, jäh verfallenen Gesichtern, die an ihr vorbeiglitten, wie ein Spuk.“
Mela Hartwig: Inferno. Roman. Mit einem Nachwort von Vojin Saša Vukadinović. Droschl Verlag, Graz 2018.
Lesen sie nächste Woche über einen Roman des donauschwäbischen Autors Johannes Weidenbaum, der tief in die Geschichte der Region eintaucht und sich dabei ausführlich dem Zweiten Weltkrieg außerhalb des Deutschen Reichs widmet.
Krafts Schattenkanon. Eine Ergänzung. Teil 38: Mela Hartwig Inferno (1948)
300 Jahre Literaturgeschichte hat sich der Münchner Schriftsteller und Publizist Thomas Kraft vorgenommen, um für das Literaturportal Bayern einige Schätze zu heben. Rund 40 unentdeckte Romane und Erzählungen deutschsprachiger Autorinnen und Autoren – darunter bekannte wie weniger bekannte – finden in dieser kurzweiligen Reihe (neu) ans Licht.
*
Mela Hartwig, 1893 als Tochter des Soziologen und Kulturphilosophen Theodor Herzl in Wien geboren, beginnt zunächst eine vielversprechende Karriere als Schauspielerin. Nach ihrer Heirat mit Robert Spira gibt sie jedoch ihre schauspielerische Laufbahn auf und zieht mit ihrem Mann nach Graz, wo dieser eine Rechtsanwaltskanzlei führt. In dieser Zeit wendet sich Hartwig dem Schreiben zu. 1927 wird ihre Novelle Das Verbrechen von Alfred Döblin bei einem Wettbewerb der Zeitschrift Die literarische Welt prämiert. Durch die Vermittlung Döblins und Stefan Zweigs kann Hartwig im darauffolgenden Jahr ihre Novellensammlung Ekstasen veröffentlichen. 1929 erscheint ihr Roman Das Weib ist ein Nichts und verursacht ebenso wie ihre Novellen einen Skandal. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und den darauffolgenden Repressionen nimmt Hartwigs Karriere ein abruptes Ende. Im Jahr 1931 sendet sie den Roman Bin ich ein überflüssiger Mensch? an den Zsolnay-Verlag in Wien, erhält jedoch im März 1933 die Absage mit den Worten: „Sie wissen, sehr verehrte gnädige Frau, dass das Weltbild des deutschen Lesepublikums und besonders der deutschen Frau heute ein anderes ist als die Lebensanschauung, die aus Ihrem Werke spricht.“
In dieser schwierigen Zeit widmet sich Hartwig der Malerei. Angesichts ihrer jüdischen Herkunft ist das Leben der Familie Spira nach dem „Anschluss“ Österreichs akut bedroht. Das Ehepaar Hartwig-Spira emigriert nach England, wo es rasch in den Freundeskreis von Virginia Woolf aufgenommen wird. 1948 kehren die Eheleute nach Graz zurück, um ihre 1938 beschlagnahmten Besitztümer zurückzufordern. Doch sie entscheiden sich, nicht länger in der steirischen Hauptstadt zu bleiben. Nach Abschluss der Rückstellungsverfahren verkaufen sie ihr Haus in Gösting sowie das Ferienhaus in Tauplitz und kehren endgültig nach London zurück, wo beide 1967 versterben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erzielt Hartwig auf dem Gebiet der Malerei, die sie unter dem Namen Mela Spira betreibt, einige Erfolge. Trotz des fortwährenden Schreibens und der Fertigstellung zahlreicher Manuskripte gelingt es ihr jedoch nicht, ein Buch zu veröffentlichen. Erst nach ihrem Tod findet ihr literarisches Werk die Anerkennung, die ihr zu Lebzeiten verwehrt bleibt. Mit einer Verspätung von siebzig Jahren wird der Roman Inferno veröffentlicht. Geschrieben wird er dagegen gleich nach dem Krieg (1946-48), als die Erinnerungen an die Wiener Exzesse der Nazi-Zeit noch frisch sind. „Ein expressives, fast filmisches Stück Literatur, das von den ersten Pogromen bis zum Kriegsende den Schattenriss einer Zeit liefert“, urteilt der Kritiker Paul Jandl.
Die Erzählung folgt der Kunststudentin Ursula und ihrer Familie inmitten einer Zeit des politischen Umbruchs. In einer Ära, die von der Verbreitung der Ideologie des Nationalsozialismus geprägt ist, entstehen neue Formen der Kunstverachtung, begleitet von einem Volk von Amokläufern, Denunzianten und fanatischen Nazis, die Pogrome inszenieren. Ursula setzt sich für die Flucht einer Freundin ein, die eine Beziehung zu einem jüdischen Mann unterhält, während ihr Geliebter im Widerstand gegen das Regime kämpft und eine Munitionsfabrik in die Luft jagt. Ihr Bruder, ein glühender Nazi, macht Karriere, zieht an die Front und fällt früh im Krieg. Der Vater bleibt in Passivität und Opportunismus gefangen, während die Mutter unter dem Leid der Familie leidet.
Hartwig schildert das Geschehen aus der Mitte des Unheils und setzt ein drastisches Vokabular ein, das die Atmosphäre der Bedrohung einfängt, die die Stadt durch die Fackelzüge in düstere Farben taucht. In dieser Atmosphäre des Fanatismus, der Angst und der Hysterie beschreibt Hartwig die kulturelle Zersetzung in präzisen Haltungen, Gesten und Mimik, und das alles aus der Sicht der jungen Frau Ursula. In einem Nachwort wird das Werk als eine Reflexion über das „innere Erleben des äußeren Schreckens“ bezeichnet. Die Gewalt bahnt sich ihren Weg, und die Ereignisse der Pogromnacht vom 9. November 1938 führen Ursula zur schmerzhaften Erkenntnis über die dramatische Schärfe der Situation. Der biblisch anmutende Satz „Der Tempel brennt“ erscheint mehrfach in Versalien, als Sinnbild für den um sich greifenden Abgrund, der Ursula von ihrer bisherigen Existenz trennt.
Ein Kommilitone begeht im Zeichensaal Selbstmord, um seiner Verhaftung zu entgehen. Ihr Geliebter erleidet im Caféhaus einen merkwürdigen Unfall, als ihm die Marmorplatte eines Tisches auf den Fuß fällt. Gegen den Künstler wird daraufhin wegen des Verdachts ermittelt, sich selbst verstümmelt zu haben, um sich der Einberufung zu entziehen. Denn inzwischen hat das Dritte Reich Polen überfallen. Ursulas Familie erlebt alle nur denkbaren Schicksalsschläge jener Zeit, eine „Flut aus Blut“. Einzig der Schrecken des Bombenkriegs bleibt ihr erspart: „Auch Ursula hörte den unheimlichen Warnungsruf der Sirene, aber nur zuweilen, denn noch wurde die Stadt, aus der steil der gotische Turm ihres geliebten, dem heiligen Stephan geweihten Domes emporstieg, geschont … Zwischen den Zeilen der Zeitungen brachen die Flammen hervor, die ferne Städte verheerten und verzehrten, die Worte, die das Radio hervorstieß, zerplatzten krachend, wie ferne Detonationen, und was Zeitungen und Radio verschwiegen, spiegelte sich in den aschgrauen, jäh verfallenen Gesichtern, die an ihr vorbeiglitten, wie ein Spuk.“
Mela Hartwig: Inferno. Roman. Mit einem Nachwort von Vojin Saša Vukadinović. Droschl Verlag, Graz 2018.
Lesen sie nächste Woche über einen Roman des donauschwäbischen Autors Johannes Weidenbaum, der tief in die Geschichte der Region eintaucht und sich dabei ausführlich dem Zweiten Weltkrieg außerhalb des Deutschen Reichs widmet.