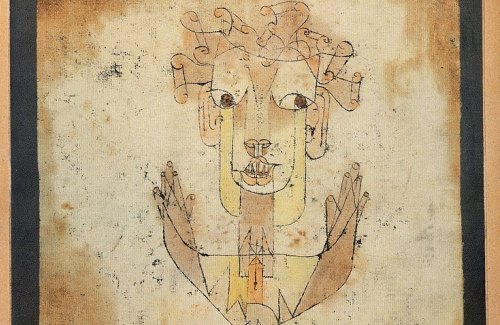Deutsch-jüdische Gespräche (13): Ein Jahr später. Lena Gorelik und Joana Osman
Zur Reihe: Zeit wahrzunehmen, zuzuhören und zu erwidern. – Angesichts eines zunehmend aufgeheizten und toxischen Kommunikationsklimas möchten wir hier einen Raum der deutsch-jüdischen Gespräche eröffnen. Denn Literatur ist immer auch ein Verhandeln und Transformieren von Wirklichkeiten und Möglichkeiten; ein Im-Gespräch-stehen. Wir laden ein zum Lesen, Zuhören und zum Erwidern; zu einem Austausch zwischen deutschsprachigen jüdischen und nichtjüdischen Schreibenden und Kunstschaffenden über alles, worüber sie jeweils miteinander reden mögen.
Das dreizehnte Gespräch führte Andrea Heuser nach einem Jahr erneut mit den Schriftstellerinnen Joana Osman und Lena Gorelik, um in Erfahrung zu bringen, was sich für sie seit dem letzten Jahr gesellschaftspolitisch und persönlich verändert hat. Dieses Gespräch fand kurz vor dem Gaza-Friedensschluss statt.
*
ANDREA HEUSER: Liebe Lena, liebe Joana, vor einem Jahr haben wir uns zuletzt miteinander unterhalten. Wir waren uns damals einig: Es gibt kein „und-sonst-so?“ im öffentlichen Gespräch. Dafür ist die Zäsur, die der 7. Oktober 2023 mit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel mit all seinen verheerenden Folgen darstellt, zu einschneidend. Unser letztes Gespräch stand zudem im Schatten der Präsidentschaftswahl in den USA. Wir befürchteten damals bereits Schlimmes. Nun springen wir mal direkt hinein, denn knapp ein Jahr ist inzwischen seit der Präsidentschaft von Donald Trump vergangen. Wie schaut es denn heute aus? Um direkt fragend ins kalte Wasser zu springen: Was gerade in den USA passiert – ist das wie eine Blaupause zu ![]() Handmaid's Tale? [Anm. d. Red. Bekannte Dystopie von Margret Atwood.]
Handmaid's Tale? [Anm. d. Red. Bekannte Dystopie von Margret Atwood.]
LENA GORELIK: Dystopien werden ja nicht gemalt, um zu sagen: so wird es. Sondern um die Frage, bewusst übertrieben, durchzuspielen: was wäre das Schlimmste? Ich habe das Gefühl, dass es genau dorthin steuert. Mich schockiert immer noch das Tempo. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Trump ist noch nicht mal ein Jahr im Amt und es gibt keine Demokratie, es gibt keine wirkliche Meinungs- und Pressefreiheit mehr. Und ich möchte auch gar nicht mehr hinfahren; wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht...
JOANA OSMAN: … dass man auch Angst haben muss dorthin zu reisen. Man wird ja gläsern, könnte googeln, was ich alles sage und schreibe. Für mich war Amerika immer – nicht umsonst habe ich Amerikanistik studiert – ein Land, das ich geliebt habe. Aber zu sehen, wie schnell ein Land, das eigentlich als Vorbild für Demokratie gegolten hat, in einen quasi-faschistischen Staat übergegangen ist, das schockiert mich und macht mich auch betroffen. Und dieses Gefühl von Dystopie, was du, Lena, gerade gesagt hattest, das ist wirklich-unwirklich. Ich sehe das manchmal von außen wie eine Art ‚Film‘. Das ist sicher eine Art der Bewältigungsstrategie. Ich hoffe immer noch auf ein Happy End.
HEUSER: Liebe Joana, nun setzt auch dein jüngstes Buch: ![]() Frieden. Eine reale Utopie, eine Narration des (positiven) Friedens jenen brachial-aggressiven Überwältigungsstrategien à la Trump entgegen. Hinter dessen Strategien steckt ja ein machtpolitisches Kalkül. Dass wir, wie du es eben beschrieben hast, Lena, nicht mehr hinterherkommen, sondern in einer permanenten Schockreaktion feststecken. Warum aber sind wir – und unter wir verstehe ich jetzt alle Demokratinnen und Demokraten dieser Welt – warum sind wir so langsam? Provokant gesagt: warum machen wir es den Rechten, den Extremisten und Faschisten aller Couleur diesbezüglich so leicht?
Frieden. Eine reale Utopie, eine Narration des (positiven) Friedens jenen brachial-aggressiven Überwältigungsstrategien à la Trump entgegen. Hinter dessen Strategien steckt ja ein machtpolitisches Kalkül. Dass wir, wie du es eben beschrieben hast, Lena, nicht mehr hinterherkommen, sondern in einer permanenten Schockreaktion feststecken. Warum aber sind wir – und unter wir verstehe ich jetzt alle Demokratinnen und Demokraten dieser Welt – warum sind wir so langsam? Provokant gesagt: warum machen wir es den Rechten, den Extremisten und Faschisten aller Couleur diesbezüglich so leicht?
OSMAN: Ich glaube, das ist ein psychologischer Mechanismus, den sich die Faschisten sehr gut zunutze machen: Je mehr du mit Absurditäten bombardiert wirst, umso schneller und schockierender das passiert, umso mehr ist die andere Seite, ist der Gegner abgelenkt; dessen Aufmerksamkeit, Kraft und Widerstandsfähigkeit wird regelrecht abgezogen. In meinem Buch habe ich das als 'Extraktivismus' beschrieben, als rücksichtslose Ausbeutung. Wir werden als Menschen mit unseren gesamten Gefühlsebenen ausgebeutet. Unsere Aufmerksamkeit wird immer irgendwohin abgelenkt. Auf diese Weise sind wir dauerbeschäftigt damit, schockiert, verängstigt, betroffen zu sein und über jedes Stöckchen zu springen, was man uns hinhält, und diese Permanenz kognitiv zu verarbeiten. Und damit haben wir überhaupt keine Zeit und Kraft mehr, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren oder auf andere Weise wirklich was dagegen zu tun.
GORELIK: Ich glaube, dass es mehr ist, als das. Denkfaulheit oder zumindest Bequemlichkeit spielt sicher auch eine Rolle. Dazu die Haltung, Demokratie als etwas Gegebenes zu nehmen. Wie man als Kind davon ausgeht, dass die Eltern sich schon kümmern. Wir sehen Demokratie a) nicht als einen Prozess und b) nicht als etwas, woran gearbeitet werden muss, an dem wir uns aktiv beteiligen müssen. Und c) aber auch nicht als wirklich gefährdet. Wir schauen jetzt in die USA, bedauern, was da geschieht, sind bestürzt – aber hier drängt es doch in dieselbe Richtung. Das wollen wir nur nicht gern wahrhaben.
HEUSER: Eine gewisse Ungeübtheit mag da auch eine Rolle spielen. Wir konnten es uns lange leisten, oder konnten es uns zumindest glaubhaft einreden, nicht allzu politisch sein zu müssen.
GORELIK: Dazu kommt, dass nicht alle gleichermaßen von den Einbußen an Freiheiten betroffen sind. Man geht ja durchaus auf die Straße. Aber dann, wenn es schon zu spät ist. Und in Deutschland geht man exakt einmal. Jede Stadt ist mal dran. Hamburg, München, Berlin wetteifern um die größten Teilnehmerzahlen und dann ist es vorbei. Aber das, was in Potsdam geplant wurde, ist nicht vorbei. Man ist einmal auf die Straße gegangen, nachdem Merz zusammen mit der AfD für das Gesetz abgestimmt hat, das die Migration nach Deutschland erschweren soll, und im Herbst sind, zumindest einige, auch einmal gegen Antisemitismus demonstrieren gewesen – aber es hat sich ja nichts geändert, weder an der menschenfeindlichen Politik noch an den steigenden Zahlen von antisemitisch und rassistisch motivierten Straftaten.
Ich will damit sagen: solange es einen selber nicht betrifft, reicht es empört zu sein. Aber es drängt einen darüber hinaus nicht dazu, tätig zu werden. Und dann gibt es auch noch den Wegguck-Reflex. Das bewusste Ich-schau-nicht-hin, im Übrigen auch ganz viel in künstlerischen, intellektuellen Kreisen; Leute, die ich für große Intellektuelle gehalten habe, die mir sagen: „Ich ertrag das alles nicht mehr, ich schau keine Nachrichten mehr.“ Das ist einfach aufgeben. Und zwar ein sehr bewusstes Aufgeben, für das man sich noch nicht mal mehr schämt. Insofern ist diese gefühlte Überforderung, diese Passivität nicht etwas, das uns einfach so passiert, sondern es ist ein bewusstes Tun.
HEUSER: Ja. Da sind natürlich wir Intellektuellen in unserer kritischen Selbstreflektion besonders gefordert, die wir ja mit Narrativen und einem hohen Maß an Wahrnehmung und auch Sprachkraft berufsmäßig umgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich durchaus auch schon bei so einer Schutzhaltung ertappt habe: „Ich schau jetzt mal drei Tage keine Nachrichten, das vergiftet mich bloß, zieht mich runter. Da hat keiner was von.“ Verbunden mit dem Gefühl, dass mir gesellschaftlich ja ständig einsuggeriert wird: ich bin eh nicht wirksam, ich habe keine Macht und meine Meinung hat keinerlei Resonanz. Aber dann überkommt mich tatsächlich, anknüpfend an das, was du sagst, Lena, die Einsicht: das geht nicht. Das geht einfach nicht! Passivität, Verdrängung, Selbstaufgabe, all das arbeitet nur den Falschen entgegen.
OSMAN: Unpolitisch sein ist eine politische Haltung. Und dem arbeitet eben das Gefühl zu: „Was kann ich denn schon tun, ich bin ja nur ein so kleines Licht.“ Oder: „Ich bin kein Politiker, keine Politikerin, ich kann die Gesetze ja nicht umstoßen.“ Das ist tatsächlich das Problem, dass wir uns die ganze Zeit als machtlos und unwirksam empfinden. Obwohl wir eigentlich die größte Macht haben. Obama hat das 2013 in Jerusalem in seiner Rede an das israelische Volk sehr klar gesagt: „Politiker gehen niemals von sich aus Risiken ein. Wenn das Volk sie nicht dazu zwingt, Risiken einzugehen.“
Also niemals von sich aus das Running System verlassen, ungewöhnliche Wege wagen, riskante Friedensverhandlungen anstoßen. Außer, das Volk fordert das explizit ein. Das ist meiner Meinung nach der Punkt. Ich glaube, dass wir das komplett verlernt haben: uns als globale Weltgemeinschaft zu sehen. Wir haben total vergessen, dass etwas, das irgendjemandem in der Ukraine, in den USA, in Gaza, in Tel Aviv passiert, dass uns das alle betrifft. Denn wir sind ja zumindest mittelbar betroffen. Wir sind immer betroffen, wenn Friede, Menschlichkeit und Demokratie wegkippen, weil alles miteinander zusammenhängt.
GORELIK: Aber das schafft man doch nicht. Entschuldige, wir schaffen es doch noch nicht mal hier. Die Menschen, die jetzt an diesem sicheren, privilegierten Ort sitzen, denken höchstwahrscheinlich sehr wenig an die Menschen, die im selben oder näheren Umfeld in prekären Umständen und ohne Schulabschluss gerade nicht wissen, wie sie ihr Essen bezahlen sollen. Jedes vierte Kind ist von Armut betroffen inzwischen. Die Menschen, die keinen in der Familie haben, der von einer Behinderung oder Einschränkung, von einer Erkrankung betroffen ist, denken nicht an Barrierefreiheit. Ich will ja keinesfalls sagen: vergiss die großen Weltprobleme. Aber ich wäre ja schon froh, wenn wir im kleineren System empathischer und wahrnehmungssensibler wären. Selfcare wird halt jetzt ganz großgeschrieben. Und dazu gehört eben auch, dass ich mich zwar mal empöre über Antisemitismus oder Rassismus oder Transfeindlichkeit, aber dann eben doch die Nachrichten wieder ausschalte, weil es mir nicht guttut und weil ich persönlich mir das auch leisten kann.
OSMAN: Aber es gibt doch auch viele Leute, die das überhaupt nicht schlimm finden. Die Rassismus gar nicht schlimm finden.
GORELIK: Ja, aber wir haben nicht die Zeit, die zu überzeugen. Ich glaube, das ist inzwischen ein Luxusproblem. Wir müssen es schaffen, diejenigen, die Rassismus schlimm finden – und Rassismus steht jetzt hier einmal für die ganzen -ismen – die müssen wir zusammenzukriegen. Und das ist, glaube ich, das Problem: es gibt keine Vision.
HEUSER: Genau das ist das Thema: Es gibt keine Vision. Gibt es wirklich keine? Was ist denn mit der Zivilgesellschaft? Was für eine Vision kann denn die Gesellschaft der Politik in demokratieschwächelnden Systemen entgegensetzen? Wie steht es, auch und gerade hier, um die Ausbildung von Zivilcourage?
OSMAN: Also, ich habe in meinem Buch genau dieses Thema der Vision als den zweiten Schritt skizziert. Von insgesamt drei Schritten, die wir gehen müssen, um aus dieser Dystopie herauszufinden. Der erste Schritt ist, dass wir die Dinge, die wir sehen und die passieren, dass wir die beim Namen nennen. Dass wir erkennen, was da passiert und dass wir uns nicht scheuen, das auszusprechen und die Dinge präzise zu benennen. Wenn Menschenrechtsverletzungen passieren. Wenn etwas faschistisch ist. Wenn die Verschiebung des Sagbaren passiert. Wir dürfen nicht versuchen, das zu relativieren. Und der zweite Schritt wäre, dass wir uns eine gemeinsame Vision, eine Zukunftsvision erstellen und die sehr stark präsent werden lassen. Die Rechtsradikalen haben nämlich so eine Zukunftsvision. Die haben sie aufgeschrieben, die verläuft nach einem Drehbuch. Wir haben noch gar keine Vision davon, wie wir eigentlich leben wollen. Natürlich haben wir Ideen, nur gibt es noch keine gemeinsame Vision, die wir uns erarbeitet haben.
Joana Osman © Mica Zeitz
HEUSER: Was die Visionen angeht, da ist Amerika traditionell ein Land, das dafürsteht. Das ist bei uns mentalitätsgeschichtlich nicht so stark ausgeprägt und dann unter den Nationalsozialisten, wo mit dem 'Herrenmenschentum' eine rassistisch-ideologische Vision aufkam, war dies „Sich-unter-einer-Vision-versammeln“ danach sozusagen verbrannt. Was ist überhaupt dieses „Wir“? Wo man sich im Alltag schon so verinselt wahrnimmt? Und wie gelänge sie uns denn, so eine produktive, positive Wir-Bildung?
OSMAN: Ich finde, dass dieses „Wir“ durchaus sehr breit sein kann. Auch divers. Da können wir wirklich von den absoluten Basics ausgehen. Alle die, die für die Demokratie sind. Damit fangen wir ja erstmal an. Also alle, die wollen, dass dieses Land eine lebendige, stabile, streitbare und dennoch positiv friedliche Demokratie bleibt. Es gibt nämlich auch viele, die das nicht wollen.
GORELIK: Aber ich glaube das Problem daran ist, dass die Rechten die Begriffe entwendet haben. Die Rechten behaupten ja jetzt auch: sie seien ja gerade für Meinungsfreiheit und offene Rede, sie seien die wahren Vertreter:innen der Demokratie…
OSMAN: ... aber genau deswegen finde ich es ja so wichtig, dass man sich das zurückholt. Dass man genau benennt, wo wirklich die Sprache gekapert wird. Dass man den Finger drauflegt und sagt: das ist ein faschistisches Playbook, das hier gerade passiert.
GORELIK: Ich saß in den letzten Jahren in vielen Kreisen abseits der Öffentlichkeit mit intellektuellen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und alle voneinander unabhängigen Kreise kamen da stets zu dem Schluss, dass man eine gemeinsame Vision braucht. Ich bin inzwischen so „müde“, weil ich denke, dass wir da immer an demselben Punkt landen werden. Dass es eben kein gemeinsames Wort oder eine gemeinsame Vision gibt, auf die man sich einigen könnte. Und immer, wenn jemand „Demokratie“ als Basic, als etwas, worauf man sich einigen könnte, aufruft, kommt der Einwurf: „aber das ist doch unsexy.“ Was ich interessant finde als Aussage …
OSMAN: Das ist doch voll egal, ob das jemand unsexy findet…
GORELIK: … ja, aber du vereinigst die Leute darunter nicht.
OSMAN: Dann nenn es „positiver Frieden“. In meinem Buch habe ich es so genannt.
GORELIK: Ich glaube auch da gehen ganz viele nicht mit. Ich will gar nicht so negativ sein, aber ich befürchte das. Wir müssen realistisch sein. Ein wichtiger Kipp-Punkt, glaube ich, war, als wir zugelassen haben, dass uns die Begriffe entwendet wurden. Eine weitere Entwicklung, die mir Sorgen macht, ist, dass wir uns haben “beibringen” lassen – von den Rechten, aber auch linke Kreise übernehmen dieses Denken, was ich extrem traurig finde – dass man sich komplett einig sein muss über bestimmte Fragen. Da greift dann sofort der Ausschlussmechanismus: wenn du nicht genauso denkst wie ich, wenn du auch nur ein „ja, aber…“ äußerst, bist du raus und ausgeschlossen. Dann gehörst du nicht zu uns. Das ist ja etwas, das die Rechten immer schon gemacht haben. Da ist kein Raum für Denken, für Ambivalenzen, fürs Hinterfragen, fürs Ergänzen. Deswegen ist eine Vision auch so schwer, weil man dann nämlich anfängt: „Ja, für Demokratie sind wir im Grunde ja alle, aber brauchen wir wirklich a, b, c und d?“ Es gibt keine Vorstellung davon, dass ein Zusammenschluss divers sein darf, auch was andere Meinungen angeht, dass Dissens nicht etwas ist, was zu Gräben führen muss. Dass man sich auf Menschenrechte einigen kann, ohne dass man dann schon die Gender-Sternchen diskutiert haben muss. Da fängt es nämlich schon an …
OSMAN:… fundamentalistisch zu werden, genau.
HEUSER: Ideologisch.
OSMAN: Aber genau deswegen müssen wir auch die ganz normalen Leute mit ins Boot holen, die sich jetzt nicht in linken, studentischen Kreisen bewegen, wo man sich mit Pronomen vorstellt, sondern die Frau G. von nebenan, die jetzt prinzipiell nichts gegen Moslems hat, aber Berührungsschwierigkeiten hat. Solche Leute haben wir ja auch im Blick und möchten sie mobilisieren. Und können uns nicht erlauben, uns in irgendwelchen intellektuellen Grabenkämpfen und Begrifflichkeiten zu verlieren. Deswegen: es sind doch einfache klare Begriffe, die jeder kennt. Es ist so wichtig, es niedrigschwellig zu machen. Es gibt ja auch nicht umsonst leichte Sprache.
HEUSER: Barrierefreiheit wird in diesem Zusammenhang dann zu einem durchaus vielschichtigen Begriff…
OSMAN: Ja. Wir müssen uns aus diesen kleinen Blasen, in denen wir uns bewegen, aus der Künstlerinnen- oder Intellektuellenblase oder wo wir uns sonst befinden, rausbegeben und ins echte Leben reinfinden. Um nochmal auf den Begriff ‚positiver Frieden‘ zurückzukommen. Ich habe ![]() Johan Galtung gelesen. Das ist ein Friedens- und Konfliktforscher. Und in der Forschung unterscheidet man zwischen zwei Arten von Frieden. Das eine ist der ‚negative Frieden‘; die bloße Abwesenheit von Gewalt und Krieg; keine Kampfhandlungen. Quasi ein Waffenstillstand. Aber ‚positiver Frieden‘ erfordert sehr viel mehr. Das ist eine Gesellschaft, in der Demokratie nicht einfach nur als Wort existiert, sondern in ihrer Tiefe gelebt wird. Das ist eine Vision, auf die man sich durchaus verständigen kann, wenn man auch nur einigermaßen menschenfreundlich denkt und ein bisschen die Ökologie im Blick hat und die Diversität, Inklusion und Integration. Das ist doch die Basis.
Johan Galtung gelesen. Das ist ein Friedens- und Konfliktforscher. Und in der Forschung unterscheidet man zwischen zwei Arten von Frieden. Das eine ist der ‚negative Frieden‘; die bloße Abwesenheit von Gewalt und Krieg; keine Kampfhandlungen. Quasi ein Waffenstillstand. Aber ‚positiver Frieden‘ erfordert sehr viel mehr. Das ist eine Gesellschaft, in der Demokratie nicht einfach nur als Wort existiert, sondern in ihrer Tiefe gelebt wird. Das ist eine Vision, auf die man sich durchaus verständigen kann, wenn man auch nur einigermaßen menschenfreundlich denkt und ein bisschen die Ökologie im Blick hat und die Diversität, Inklusion und Integration. Das ist doch die Basis.
HEUSER: Ja, schon. Aber ich frage mich trotzdem, was gerade passiert. Denn ich würde jetzt mal behaupten: das war doch die letzten vierzig Jahre, zumindest im Großen und Ganzen so, dass wir in Deutschland mehrheitsgesellschaftlich diese Basis hatten. Was hat sich also verändert? Natürlich hatten wir da auch Antisemitismus und alle anderen -ismen; aber nicht in dieser verbalen, geradezu selbstverständlichen Wucht. Bis vor einigen Jahren hätte ich gesagt: wir können uns darauf verlassen, dass diese demokratische Basis ziemlich stabil ist und trägt. Es hätte keiner eine Reichsflagge gehisst …
OSMAN: Ich glaube, zweierlei ist passiert. Zum einen ist die Gesellschaft woke-er geworden. Was eigentlich was Gutes ist. Dass man die Missstände, die in den 90ern ebenso da waren, wie etwa Homophobie, Frauenfeindlichkeit etc., die aber eben unterm Radar liefen – dass man die nun stärker benennt und damit an die Oberfläche holt und sichtbarer macht. Weil die Mehrheitsgesellschaft das nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Schon gar nicht in den öffentlichen Diskursen. Dann haben die marginalisierten Gruppen etwas mehr Selbstbewusstsein bekommen, sind aufgestanden, haben die Finger in die Wunden gelegt und dadurch wiederum hat sich eine Spaltung ergeben. Von Leuten, die sich dadurch getriggert gefühlt haben und das nicht wahrhaben wollten.
GORELIK: Die Rechten haben sich dazu extrem gut aufgestellt; das muss man leider auch sagen. Und zwar weltweit. Sie haben sich gegenseitig den Weg freigeschaufelt. Dadurch, dass beispielsweise in Polen über Abtreibung diskutiert wurde, haben sie das hier wieder aufgerufen, oder wenn Trump was macht, dann wird das von den Rechten in Europa gespiegelt und so weiter. Sie haben es geschafft, sich aus der sozialen Ächtung herauszuschaufeln. Heute kannst du problemlos in jeder Umfrage sagen, ich wähl die AfD. Sie sind aus der No-Go-Area raus und haben gute Strategien entwickelt.
OSMAN: Und trotzdem sind sie doch eine Minderheit.
GORELIK: Nein, das ist ein Viertel. Ich halte ein Viertel nicht für eine Minderheit.
OSMAN: Aber rein rechnerisch sind doch immer noch Dreiviertel dafür, für die Demokratie…
GORELIK: … es läuft zahlenmäßig fast auf eine Polarisierung hinaus inzwischen…
HEUSER: Das sehe ich auch so.
OSMAN: Ja, ich nehme es zurück, wenn man sich die Zahlen jetzt ansieht; da habt ihr völlig recht. Es ist tatsächlich wohl eine fifty-fifty-Situation. Wir müssen uns gerade deswegen aber trotzdem bewusstmachen, wie wichtig ein Zusammenschluss ist. Du hast es gerade gesagt, Lena: die Rechten haben sich weltweit vernetzt.
HEUSER: Bedeutet das nicht, dass wir im Grunde erstmalig wirklich offen, weil mit Blick auf die zuvor unter den Teppich gekehrten Wunden und Missstände über das reden, was gelebte Demokratie eigentlich sein soll? Sprich, ist die Stabilität der Demokratie möglicherweise auch lange Zeit durch Sillschweigen und Nivellieren von Differenzen erkauft worden? Besteht, positiv gesprochen, neben der Abgrenzung nach rechts, jetzt nicht auch die Chance, Demokratie gleichberechtigter und menschenfreundlicher zu schaffen?
Lena Gorelik © Gerald von Foris/Graf Verlag
GORELIK: Was wichtig ist, ist sich daran zu erinnern, was Demokratie schon immer war oder sein sollte: nämlich ein Aushandeln, ein Diskurs. Was uns, glaube ich, gerade am Meisten lähmt, ist diese Dichotomie, die Polarisierung, die wir als Status Quo annehmen. Und das ist eben leider etwas, was die Rechten vielleicht hergestellt haben, aber wir auch annehmen und übernehmen. Und dann gibt es eben überhaupt keinen Diskurs mehr. Mir fallen öffentlich keine Räume mehr ein, und ich meine wirklich: keine; mir fällt tatsächlich keine Institution ein, wo das noch möglich ist, wo Diskurs im ursprünglichen Sinne dieses Wortes wie ein „Durchwandeln“ praktiziert wird. Also nicht gegeneinander – wobei es auch das nicht mehr wirklich gibt, weil man sich ja gar nicht mehr zuhörend begegnet. Es gibt kein Ich-höre-zu-ich-erwidere; sondern nur noch ein Ich-schieße-dagegen. Die Realität ist doch: da sitzen die drei auf dem Podium, die dieser Meinung sind, und da drüben, da sitzen die, die anderer Meinung sind. Die ursprünglichen Mechanismen von Demokratie, zu denen Volksentscheid, auf die Straße gehen, Diskurs gehört, sich auseinandersetzen, streiten, zuhören, umdenken, miteinander denken, die sind uns verloren gegangen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Demokratie Arbeit ist, eine Arbeit, die von uns allen getan werden muss.
HEUSER: Wie schafft man diesen Raum denn aber zuallererst, was wir hier ja auch mit den deutsch-jüdischen Gesprächen, als einem Zuhören und Erwidern, anstreben? Ist die Kunst, ist die Literatur ein solcher Raum?
OSMAN: Ja. Aber nein auch. Weil die Kunst sich ja immer wieder selbst reproduziert. Wenn wir von einem Raum sprechen, den wir brauchen, um uns zu begegnen als gleichwertige Menschen auf einer Ebene, dann müssen wir einen Raum entwerfen. Jeder Raum hat Grenzen, hat eine Begrenzung. Sonst wäre er kein Raum. Auch ein metaphorischer Raum braucht Grenzen, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir die Grenzen des Sagbaren immer mehr nach rechts verschieben, dann haben wir den gesamten Raum im rechten Eck. Deswegen finde ich, dass wir uns zuallererst einmal klarmachen müssen, wo die Grenzen sind, innerhalb derer wir uns bewegen. Da müssen wir als Gesellschaft aufschreien, wenn wieder eine Konsensgrenze fällt. Wenn etwas klar rassistisch ist, aber als kontroverse Meinung geframt wird. Das ist keine politische Haltung, das ist Faschismus, was in den USA passiert: dieses Reframing zugunsten des rechtsradikalen Rahmens.
HEUSER: Nochmal nachgefragt, weil du eben gesagt hast, dass Kunst sich ja nur bedingt als Raum eignet. Literatur ist aber doch ein Raum, um dieses Reframing, das du hier ansprichst, ins kritische Narrativ zu holen, zu entlarven. Sie kann doch ein Achtsamkeitsraum sein, Diversität spiegeln und Visionen. Oder warum würdest du sagen, dass sich Literatur hier nicht eignet?
OSMAN: Weils total abgehoben ist. Das spielen wir uns nur gegenseitig den Ball zu. Das sieht man ja schon an der Sprache. Ich rede man wieder von der Tante G. von nebenan. Die kommt da nicht mit in diesem „Literaturhaus“.
GORELIK: Das glaube ich nicht. Natürlich ist Literatur oft abgehoben. Und trotzdem: es gibt unterschiedliche Literatur, es gibt unterschiedliche Zugänge. Vielleicht will ich auch dran glauben; ich will an die Kraft von Kunst glauben…
OSMAN: … ich auch.
GORELIK: Kunst im weitesten Sinne. Auch Filme. Ein gutes Beispiel ist Netflix. Diese ganzen Teenager-Serien, die mit einer Selbstverständlichkeit ihre Figuren queer und trans sein lassen. Wenn man die Jugendlichen und die Studien dazu anschaut, dann gehen sie mit diesen Begriffen mit einer Selbstverständlichkeit um, die es in meiner Generation nicht gab. Das ist auch der Verdienst von Netflix und Co. Nicht, weil jemand pädagogisch gesagt hat: es ist ganz wichtig, dass wir alle Sexualitäten gleichwertig annehmen, sondern weil sie eine Selbstverständlichkeit sehen, die sie übernehmen. Literatur und Kunst im weitesten Sinne hat jenseits vom Literaturhauspublikum eine Ausstrahlungskraft, die größer ist, als wir glauben. Ich jedenfalls brauche im Moment die Stärke von anderen Büchern. Menschen, die offen zum Beispiel darüber schreiben, was der Krieg in Israel und Gaza mit ihnen macht. Mir gibt eine solche Lesung eine Stärke, wie sonst lange nichts, sie hält mich aufrecht. Und vielleicht hält jemanden im Publikum mein Vortrag aufrecht, so. Wir geben einander Stärke.
HEUSER: Das ist ganz elementar. Wir lesen, um zu erfahren, dass wir nicht allein sind.
OSMAN: Natürlich glaube ich das auch. Sonst würde ich nicht schreiben, ganz klar. Und ich sehe auch, dass Kunst in jeder Form emotionalisiert. Das ist aber genau das, was ich meine, was uns gesellschaftlich fehlt: wir brauchen Narrative. Weil wir es immer mit Geschichten zu tun haben. Das ist das, was uns ausmacht. Wir definieren uns über Narrative, wir definieren aber auch die Anderen über Narrative. Unsere ganze Kultur und unser Selbstverständnis basiert immer auf Geschichten. Und die Faschisten haben das wahnsinnig gut verstanden. Die haben nämlich ein sehr kraftvolles Narrativ.
Und es verfängt deswegen so sehr, weil Angst, die Angst vor ‚Überfremdung‘ zum Beispiel, so ein starker Treiber ist. Weil Angst die stärkste Emotion ist. Und Geschichten funktionieren nur mit Emotionen. Sonst wären es keine Geschichten. Und wenn wir jetzt anfangen uns auf so einer intellektuellen Ebene mit Faktenchecks dagegenzustellen- so wichtig Fakten natürlich sind – damit allein ziehen wir den Kürzeren. Was wir nicht haben, ist ein wirksames Gegennarrativ.
GORELIK: Das stimmt. Aber deren Narrative sind ja sehr einfach. Es sind sehr simple Erzählungen, die sie uns aufgedrückt haben; in denen gibt es Gut und Böse, das funktioniert wie im Märchen. Wir müssen auch eine gute Erzählung finden. Ich glaube, das ist fatal. Und falsch. Umgekehrt: wir müssen Fakten und Bildung wieder interessant machen.
OSMAN: Ja, schon. Aber wie machen wir sie interessant? Indem sie wir sie erzählen.
GORELIK: Ich habe das Gefühl, wir reagieren nur, wir laufen [den Rechten] auch da hinterher. Reagieren [empört] auf deren Themensetzungen wie „Flüchtlinge sind böse“; wir übernehmen deren Mechanismen. Ich glaube, wir müssen anders denken. Wir müssen aus deren Denken hinaus; aus deren Dichotomien, wir müssen eigene Geschichten schaffen.
OSMAN: Aber das ist ja genau der Punkt. Da bin ich eben wieder bei der Vision. Unser Hirn ist ja evolutionsbiologisch dergestalt, dass wir Geschichten eher glauben als bloßen Daten, Zahlen, Fakten; weil Geschichten im limbischen System verarbeitet werden. Und Daten, Zahlen, Fakten im Frontallappen. Und wenn wir Geschichten hören, reagieren wir emotionaler und deswegen verfängt das mehr. Und wenn wir versuchen, diesen toxischen Narrativen einfach nur die nackten Zahlen aus Statistiken entgegenzuhalten, dann verliert man. Man merkt sich das nicht. Deswegen nochmal: wir brauchen eine Vision. Die muss ja gar nicht einfach und eindimensional sein. Aber wir brauchen eine, die genauso emotionalisiert. Und da rede ich jetzt nicht von ‚hell‘ gegen ‚dunkel‘ im Märchengewand. Sondern, das ist einfach etwas, das wir bewirken können und dass uns zeigt, wir nicht allein sind.
HEUSER: Aber da würde ich jetzt mal einhaken; wir haben doch diese Narrative. Um mit der Serie Adolescence mal bewusst ein Beispiel aus der Populärkultur zu nehmen; diese Serie hat tatsächlich politisch eingewirkt. Das englische Parlament hat, ausgelöst von deren intensiver Resonanz in der Bevölkerung, also in bewusster Replik auf die Auseinandersetzung mit dem Zusammenhängen von Gewalt und Sozial-Media-Framing, die in der Serie Thema sind, strengere Gesetze beschlossen. An den Schulen wurde intensiv über die Serie, in deren Fokus ein 13jähriger Mörder steht, diskutiert. Dies ist also ein Beispiel für ein gelungenes, differenziert-kritisches Narrativ, das eben auch Fakten und Erkenntnisse aus der Soziologie verarbeitet, das aber als hochemotionale packende Geschichte erzählt wird. Was deiner Argumentation, Joana, ja durchaus entgegenkommt. Meine Frage wäre: warum nehmen wir dieses Narrativ oder ähnliche Geschichten aber nicht als so machtvoll wahr, wie sie eigentlich doch sind?
OSMAN: Weil es heterogen ist. Heterogene Visionen [der Kunst] nehmen wir nicht als Einheit war.
GORELIK: Ich glaube, dass Heterogenität gerade gut ist. Die Rechten machen es eindimensional. Wir sollten mehrdimensional bleiben. Wir müssen mehr das sehen, was bereits da ist, was wie Blumen überall sprießt… Was aus meiner Erfahrung die größte Wirkung auf öffentlichen Diskussionsbühnen hat, ist nicht, wie fast immer vorgegeben, zum x-ten Mal über die Krise zu diskutieren, sondern stattdessen zum Beispiel gemeinsam öffentlich Gedichte zu lesen. Jeder bringt einen Text mit, der ihn anspricht, der etwas zur Lage, zu unserer Zeit, zu unseren Ängsten auf seine Art mitteilt. Da wirken und bewirken Worte etwas; es ist eine gemeinsame Erfahrung, sie zu hören.
OSMAN: Das ist genau das, was ich meine: Von der Schönheit der Heterogenität können und sollten wir erzählen.
HEUSER: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank euch beiden für das anregende Gespräch!
Deutsch-jüdische Gespräche (13): Ein Jahr später. Lena Gorelik und Joana Osman
Zur Reihe: Zeit wahrzunehmen, zuzuhören und zu erwidern. – Angesichts eines zunehmend aufgeheizten und toxischen Kommunikationsklimas möchten wir hier einen Raum der deutsch-jüdischen Gespräche eröffnen. Denn Literatur ist immer auch ein Verhandeln und Transformieren von Wirklichkeiten und Möglichkeiten; ein Im-Gespräch-stehen. Wir laden ein zum Lesen, Zuhören und zum Erwidern; zu einem Austausch zwischen deutschsprachigen jüdischen und nichtjüdischen Schreibenden und Kunstschaffenden über alles, worüber sie jeweils miteinander reden mögen.
Das dreizehnte Gespräch führte Andrea Heuser nach einem Jahr erneut mit den Schriftstellerinnen Joana Osman und Lena Gorelik, um in Erfahrung zu bringen, was sich für sie seit dem letzten Jahr gesellschaftspolitisch und persönlich verändert hat. Dieses Gespräch fand kurz vor dem Gaza-Friedensschluss statt.
*
ANDREA HEUSER: Liebe Lena, liebe Joana, vor einem Jahr haben wir uns zuletzt miteinander unterhalten. Wir waren uns damals einig: Es gibt kein „und-sonst-so?“ im öffentlichen Gespräch. Dafür ist die Zäsur, die der 7. Oktober 2023 mit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel mit all seinen verheerenden Folgen darstellt, zu einschneidend. Unser letztes Gespräch stand zudem im Schatten der Präsidentschaftswahl in den USA. Wir befürchteten damals bereits Schlimmes. Nun springen wir mal direkt hinein, denn knapp ein Jahr ist inzwischen seit der Präsidentschaft von Donald Trump vergangen. Wie schaut es denn heute aus? Um direkt fragend ins kalte Wasser zu springen: Was gerade in den USA passiert – ist das wie eine Blaupause zu ![]() Handmaid's Tale? [Anm. d. Red. Bekannte Dystopie von Margret Atwood.]
Handmaid's Tale? [Anm. d. Red. Bekannte Dystopie von Margret Atwood.]
LENA GORELIK: Dystopien werden ja nicht gemalt, um zu sagen: so wird es. Sondern um die Frage, bewusst übertrieben, durchzuspielen: was wäre das Schlimmste? Ich habe das Gefühl, dass es genau dorthin steuert. Mich schockiert immer noch das Tempo. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Trump ist noch nicht mal ein Jahr im Amt und es gibt keine Demokratie, es gibt keine wirkliche Meinungs- und Pressefreiheit mehr. Und ich möchte auch gar nicht mehr hinfahren; wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht...
JOANA OSMAN: … dass man auch Angst haben muss dorthin zu reisen. Man wird ja gläsern, könnte googeln, was ich alles sage und schreibe. Für mich war Amerika immer – nicht umsonst habe ich Amerikanistik studiert – ein Land, das ich geliebt habe. Aber zu sehen, wie schnell ein Land, das eigentlich als Vorbild für Demokratie gegolten hat, in einen quasi-faschistischen Staat übergegangen ist, das schockiert mich und macht mich auch betroffen. Und dieses Gefühl von Dystopie, was du, Lena, gerade gesagt hattest, das ist wirklich-unwirklich. Ich sehe das manchmal von außen wie eine Art ‚Film‘. Das ist sicher eine Art der Bewältigungsstrategie. Ich hoffe immer noch auf ein Happy End.
HEUSER: Liebe Joana, nun setzt auch dein jüngstes Buch: ![]() Frieden. Eine reale Utopie, eine Narration des (positiven) Friedens jenen brachial-aggressiven Überwältigungsstrategien à la Trump entgegen. Hinter dessen Strategien steckt ja ein machtpolitisches Kalkül. Dass wir, wie du es eben beschrieben hast, Lena, nicht mehr hinterherkommen, sondern in einer permanenten Schockreaktion feststecken. Warum aber sind wir – und unter wir verstehe ich jetzt alle Demokratinnen und Demokraten dieser Welt – warum sind wir so langsam? Provokant gesagt: warum machen wir es den Rechten, den Extremisten und Faschisten aller Couleur diesbezüglich so leicht?
Frieden. Eine reale Utopie, eine Narration des (positiven) Friedens jenen brachial-aggressiven Überwältigungsstrategien à la Trump entgegen. Hinter dessen Strategien steckt ja ein machtpolitisches Kalkül. Dass wir, wie du es eben beschrieben hast, Lena, nicht mehr hinterherkommen, sondern in einer permanenten Schockreaktion feststecken. Warum aber sind wir – und unter wir verstehe ich jetzt alle Demokratinnen und Demokraten dieser Welt – warum sind wir so langsam? Provokant gesagt: warum machen wir es den Rechten, den Extremisten und Faschisten aller Couleur diesbezüglich so leicht?
OSMAN: Ich glaube, das ist ein psychologischer Mechanismus, den sich die Faschisten sehr gut zunutze machen: Je mehr du mit Absurditäten bombardiert wirst, umso schneller und schockierender das passiert, umso mehr ist die andere Seite, ist der Gegner abgelenkt; dessen Aufmerksamkeit, Kraft und Widerstandsfähigkeit wird regelrecht abgezogen. In meinem Buch habe ich das als 'Extraktivismus' beschrieben, als rücksichtslose Ausbeutung. Wir werden als Menschen mit unseren gesamten Gefühlsebenen ausgebeutet. Unsere Aufmerksamkeit wird immer irgendwohin abgelenkt. Auf diese Weise sind wir dauerbeschäftigt damit, schockiert, verängstigt, betroffen zu sein und über jedes Stöckchen zu springen, was man uns hinhält, und diese Permanenz kognitiv zu verarbeiten. Und damit haben wir überhaupt keine Zeit und Kraft mehr, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren oder auf andere Weise wirklich was dagegen zu tun.
GORELIK: Ich glaube, dass es mehr ist, als das. Denkfaulheit oder zumindest Bequemlichkeit spielt sicher auch eine Rolle. Dazu die Haltung, Demokratie als etwas Gegebenes zu nehmen. Wie man als Kind davon ausgeht, dass die Eltern sich schon kümmern. Wir sehen Demokratie a) nicht als einen Prozess und b) nicht als etwas, woran gearbeitet werden muss, an dem wir uns aktiv beteiligen müssen. Und c) aber auch nicht als wirklich gefährdet. Wir schauen jetzt in die USA, bedauern, was da geschieht, sind bestürzt – aber hier drängt es doch in dieselbe Richtung. Das wollen wir nur nicht gern wahrhaben.
HEUSER: Eine gewisse Ungeübtheit mag da auch eine Rolle spielen. Wir konnten es uns lange leisten, oder konnten es uns zumindest glaubhaft einreden, nicht allzu politisch sein zu müssen.
GORELIK: Dazu kommt, dass nicht alle gleichermaßen von den Einbußen an Freiheiten betroffen sind. Man geht ja durchaus auf die Straße. Aber dann, wenn es schon zu spät ist. Und in Deutschland geht man exakt einmal. Jede Stadt ist mal dran. Hamburg, München, Berlin wetteifern um die größten Teilnehmerzahlen und dann ist es vorbei. Aber das, was in Potsdam geplant wurde, ist nicht vorbei. Man ist einmal auf die Straße gegangen, nachdem Merz zusammen mit der AfD für das Gesetz abgestimmt hat, das die Migration nach Deutschland erschweren soll, und im Herbst sind, zumindest einige, auch einmal gegen Antisemitismus demonstrieren gewesen – aber es hat sich ja nichts geändert, weder an der menschenfeindlichen Politik noch an den steigenden Zahlen von antisemitisch und rassistisch motivierten Straftaten.
Ich will damit sagen: solange es einen selber nicht betrifft, reicht es empört zu sein. Aber es drängt einen darüber hinaus nicht dazu, tätig zu werden. Und dann gibt es auch noch den Wegguck-Reflex. Das bewusste Ich-schau-nicht-hin, im Übrigen auch ganz viel in künstlerischen, intellektuellen Kreisen; Leute, die ich für große Intellektuelle gehalten habe, die mir sagen: „Ich ertrag das alles nicht mehr, ich schau keine Nachrichten mehr.“ Das ist einfach aufgeben. Und zwar ein sehr bewusstes Aufgeben, für das man sich noch nicht mal mehr schämt. Insofern ist diese gefühlte Überforderung, diese Passivität nicht etwas, das uns einfach so passiert, sondern es ist ein bewusstes Tun.
HEUSER: Ja. Da sind natürlich wir Intellektuellen in unserer kritischen Selbstreflektion besonders gefordert, die wir ja mit Narrativen und einem hohen Maß an Wahrnehmung und auch Sprachkraft berufsmäßig umgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich durchaus auch schon bei so einer Schutzhaltung ertappt habe: „Ich schau jetzt mal drei Tage keine Nachrichten, das vergiftet mich bloß, zieht mich runter. Da hat keiner was von.“ Verbunden mit dem Gefühl, dass mir gesellschaftlich ja ständig einsuggeriert wird: ich bin eh nicht wirksam, ich habe keine Macht und meine Meinung hat keinerlei Resonanz. Aber dann überkommt mich tatsächlich, anknüpfend an das, was du sagst, Lena, die Einsicht: das geht nicht. Das geht einfach nicht! Passivität, Verdrängung, Selbstaufgabe, all das arbeitet nur den Falschen entgegen.
OSMAN: Unpolitisch sein ist eine politische Haltung. Und dem arbeitet eben das Gefühl zu: „Was kann ich denn schon tun, ich bin ja nur ein so kleines Licht.“ Oder: „Ich bin kein Politiker, keine Politikerin, ich kann die Gesetze ja nicht umstoßen.“ Das ist tatsächlich das Problem, dass wir uns die ganze Zeit als machtlos und unwirksam empfinden. Obwohl wir eigentlich die größte Macht haben. Obama hat das 2013 in Jerusalem in seiner Rede an das israelische Volk sehr klar gesagt: „Politiker gehen niemals von sich aus Risiken ein. Wenn das Volk sie nicht dazu zwingt, Risiken einzugehen.“
Also niemals von sich aus das Running System verlassen, ungewöhnliche Wege wagen, riskante Friedensverhandlungen anstoßen. Außer, das Volk fordert das explizit ein. Das ist meiner Meinung nach der Punkt. Ich glaube, dass wir das komplett verlernt haben: uns als globale Weltgemeinschaft zu sehen. Wir haben total vergessen, dass etwas, das irgendjemandem in der Ukraine, in den USA, in Gaza, in Tel Aviv passiert, dass uns das alle betrifft. Denn wir sind ja zumindest mittelbar betroffen. Wir sind immer betroffen, wenn Friede, Menschlichkeit und Demokratie wegkippen, weil alles miteinander zusammenhängt.
GORELIK: Aber das schafft man doch nicht. Entschuldige, wir schaffen es doch noch nicht mal hier. Die Menschen, die jetzt an diesem sicheren, privilegierten Ort sitzen, denken höchstwahrscheinlich sehr wenig an die Menschen, die im selben oder näheren Umfeld in prekären Umständen und ohne Schulabschluss gerade nicht wissen, wie sie ihr Essen bezahlen sollen. Jedes vierte Kind ist von Armut betroffen inzwischen. Die Menschen, die keinen in der Familie haben, der von einer Behinderung oder Einschränkung, von einer Erkrankung betroffen ist, denken nicht an Barrierefreiheit. Ich will ja keinesfalls sagen: vergiss die großen Weltprobleme. Aber ich wäre ja schon froh, wenn wir im kleineren System empathischer und wahrnehmungssensibler wären. Selfcare wird halt jetzt ganz großgeschrieben. Und dazu gehört eben auch, dass ich mich zwar mal empöre über Antisemitismus oder Rassismus oder Transfeindlichkeit, aber dann eben doch die Nachrichten wieder ausschalte, weil es mir nicht guttut und weil ich persönlich mir das auch leisten kann.
OSMAN: Aber es gibt doch auch viele Leute, die das überhaupt nicht schlimm finden. Die Rassismus gar nicht schlimm finden.
GORELIK: Ja, aber wir haben nicht die Zeit, die zu überzeugen. Ich glaube, das ist inzwischen ein Luxusproblem. Wir müssen es schaffen, diejenigen, die Rassismus schlimm finden – und Rassismus steht jetzt hier einmal für die ganzen -ismen – die müssen wir zusammenzukriegen. Und das ist, glaube ich, das Problem: es gibt keine Vision.
HEUSER: Genau das ist das Thema: Es gibt keine Vision. Gibt es wirklich keine? Was ist denn mit der Zivilgesellschaft? Was für eine Vision kann denn die Gesellschaft der Politik in demokratieschwächelnden Systemen entgegensetzen? Wie steht es, auch und gerade hier, um die Ausbildung von Zivilcourage?
OSMAN: Also, ich habe in meinem Buch genau dieses Thema der Vision als den zweiten Schritt skizziert. Von insgesamt drei Schritten, die wir gehen müssen, um aus dieser Dystopie herauszufinden. Der erste Schritt ist, dass wir die Dinge, die wir sehen und die passieren, dass wir die beim Namen nennen. Dass wir erkennen, was da passiert und dass wir uns nicht scheuen, das auszusprechen und die Dinge präzise zu benennen. Wenn Menschenrechtsverletzungen passieren. Wenn etwas faschistisch ist. Wenn die Verschiebung des Sagbaren passiert. Wir dürfen nicht versuchen, das zu relativieren. Und der zweite Schritt wäre, dass wir uns eine gemeinsame Vision, eine Zukunftsvision erstellen und die sehr stark präsent werden lassen. Die Rechtsradikalen haben nämlich so eine Zukunftsvision. Die haben sie aufgeschrieben, die verläuft nach einem Drehbuch. Wir haben noch gar keine Vision davon, wie wir eigentlich leben wollen. Natürlich haben wir Ideen, nur gibt es noch keine gemeinsame Vision, die wir uns erarbeitet haben.
Joana Osman © Mica Zeitz
HEUSER: Was die Visionen angeht, da ist Amerika traditionell ein Land, das dafürsteht. Das ist bei uns mentalitätsgeschichtlich nicht so stark ausgeprägt und dann unter den Nationalsozialisten, wo mit dem 'Herrenmenschentum' eine rassistisch-ideologische Vision aufkam, war dies „Sich-unter-einer-Vision-versammeln“ danach sozusagen verbrannt. Was ist überhaupt dieses „Wir“? Wo man sich im Alltag schon so verinselt wahrnimmt? Und wie gelänge sie uns denn, so eine produktive, positive Wir-Bildung?
OSMAN: Ich finde, dass dieses „Wir“ durchaus sehr breit sein kann. Auch divers. Da können wir wirklich von den absoluten Basics ausgehen. Alle die, die für die Demokratie sind. Damit fangen wir ja erstmal an. Also alle, die wollen, dass dieses Land eine lebendige, stabile, streitbare und dennoch positiv friedliche Demokratie bleibt. Es gibt nämlich auch viele, die das nicht wollen.
GORELIK: Aber ich glaube das Problem daran ist, dass die Rechten die Begriffe entwendet haben. Die Rechten behaupten ja jetzt auch: sie seien ja gerade für Meinungsfreiheit und offene Rede, sie seien die wahren Vertreter:innen der Demokratie…
OSMAN: ... aber genau deswegen finde ich es ja so wichtig, dass man sich das zurückholt. Dass man genau benennt, wo wirklich die Sprache gekapert wird. Dass man den Finger drauflegt und sagt: das ist ein faschistisches Playbook, das hier gerade passiert.
GORELIK: Ich saß in den letzten Jahren in vielen Kreisen abseits der Öffentlichkeit mit intellektuellen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und alle voneinander unabhängigen Kreise kamen da stets zu dem Schluss, dass man eine gemeinsame Vision braucht. Ich bin inzwischen so „müde“, weil ich denke, dass wir da immer an demselben Punkt landen werden. Dass es eben kein gemeinsames Wort oder eine gemeinsame Vision gibt, auf die man sich einigen könnte. Und immer, wenn jemand „Demokratie“ als Basic, als etwas, worauf man sich einigen könnte, aufruft, kommt der Einwurf: „aber das ist doch unsexy.“ Was ich interessant finde als Aussage …
OSMAN: Das ist doch voll egal, ob das jemand unsexy findet…
GORELIK: … ja, aber du vereinigst die Leute darunter nicht.
OSMAN: Dann nenn es „positiver Frieden“. In meinem Buch habe ich es so genannt.
GORELIK: Ich glaube auch da gehen ganz viele nicht mit. Ich will gar nicht so negativ sein, aber ich befürchte das. Wir müssen realistisch sein. Ein wichtiger Kipp-Punkt, glaube ich, war, als wir zugelassen haben, dass uns die Begriffe entwendet wurden. Eine weitere Entwicklung, die mir Sorgen macht, ist, dass wir uns haben “beibringen” lassen – von den Rechten, aber auch linke Kreise übernehmen dieses Denken, was ich extrem traurig finde – dass man sich komplett einig sein muss über bestimmte Fragen. Da greift dann sofort der Ausschlussmechanismus: wenn du nicht genauso denkst wie ich, wenn du auch nur ein „ja, aber…“ äußerst, bist du raus und ausgeschlossen. Dann gehörst du nicht zu uns. Das ist ja etwas, das die Rechten immer schon gemacht haben. Da ist kein Raum für Denken, für Ambivalenzen, fürs Hinterfragen, fürs Ergänzen. Deswegen ist eine Vision auch so schwer, weil man dann nämlich anfängt: „Ja, für Demokratie sind wir im Grunde ja alle, aber brauchen wir wirklich a, b, c und d?“ Es gibt keine Vorstellung davon, dass ein Zusammenschluss divers sein darf, auch was andere Meinungen angeht, dass Dissens nicht etwas ist, was zu Gräben führen muss. Dass man sich auf Menschenrechte einigen kann, ohne dass man dann schon die Gender-Sternchen diskutiert haben muss. Da fängt es nämlich schon an …
OSMAN:… fundamentalistisch zu werden, genau.
HEUSER: Ideologisch.
OSMAN: Aber genau deswegen müssen wir auch die ganz normalen Leute mit ins Boot holen, die sich jetzt nicht in linken, studentischen Kreisen bewegen, wo man sich mit Pronomen vorstellt, sondern die Frau G. von nebenan, die jetzt prinzipiell nichts gegen Moslems hat, aber Berührungsschwierigkeiten hat. Solche Leute haben wir ja auch im Blick und möchten sie mobilisieren. Und können uns nicht erlauben, uns in irgendwelchen intellektuellen Grabenkämpfen und Begrifflichkeiten zu verlieren. Deswegen: es sind doch einfache klare Begriffe, die jeder kennt. Es ist so wichtig, es niedrigschwellig zu machen. Es gibt ja auch nicht umsonst leichte Sprache.
HEUSER: Barrierefreiheit wird in diesem Zusammenhang dann zu einem durchaus vielschichtigen Begriff…
OSMAN: Ja. Wir müssen uns aus diesen kleinen Blasen, in denen wir uns bewegen, aus der Künstlerinnen- oder Intellektuellenblase oder wo wir uns sonst befinden, rausbegeben und ins echte Leben reinfinden. Um nochmal auf den Begriff ‚positiver Frieden‘ zurückzukommen. Ich habe ![]() Johan Galtung gelesen. Das ist ein Friedens- und Konfliktforscher. Und in der Forschung unterscheidet man zwischen zwei Arten von Frieden. Das eine ist der ‚negative Frieden‘; die bloße Abwesenheit von Gewalt und Krieg; keine Kampfhandlungen. Quasi ein Waffenstillstand. Aber ‚positiver Frieden‘ erfordert sehr viel mehr. Das ist eine Gesellschaft, in der Demokratie nicht einfach nur als Wort existiert, sondern in ihrer Tiefe gelebt wird. Das ist eine Vision, auf die man sich durchaus verständigen kann, wenn man auch nur einigermaßen menschenfreundlich denkt und ein bisschen die Ökologie im Blick hat und die Diversität, Inklusion und Integration. Das ist doch die Basis.
Johan Galtung gelesen. Das ist ein Friedens- und Konfliktforscher. Und in der Forschung unterscheidet man zwischen zwei Arten von Frieden. Das eine ist der ‚negative Frieden‘; die bloße Abwesenheit von Gewalt und Krieg; keine Kampfhandlungen. Quasi ein Waffenstillstand. Aber ‚positiver Frieden‘ erfordert sehr viel mehr. Das ist eine Gesellschaft, in der Demokratie nicht einfach nur als Wort existiert, sondern in ihrer Tiefe gelebt wird. Das ist eine Vision, auf die man sich durchaus verständigen kann, wenn man auch nur einigermaßen menschenfreundlich denkt und ein bisschen die Ökologie im Blick hat und die Diversität, Inklusion und Integration. Das ist doch die Basis.
HEUSER: Ja, schon. Aber ich frage mich trotzdem, was gerade passiert. Denn ich würde jetzt mal behaupten: das war doch die letzten vierzig Jahre, zumindest im Großen und Ganzen so, dass wir in Deutschland mehrheitsgesellschaftlich diese Basis hatten. Was hat sich also verändert? Natürlich hatten wir da auch Antisemitismus und alle anderen -ismen; aber nicht in dieser verbalen, geradezu selbstverständlichen Wucht. Bis vor einigen Jahren hätte ich gesagt: wir können uns darauf verlassen, dass diese demokratische Basis ziemlich stabil ist und trägt. Es hätte keiner eine Reichsflagge gehisst …
OSMAN: Ich glaube, zweierlei ist passiert. Zum einen ist die Gesellschaft woke-er geworden. Was eigentlich was Gutes ist. Dass man die Missstände, die in den 90ern ebenso da waren, wie etwa Homophobie, Frauenfeindlichkeit etc., die aber eben unterm Radar liefen – dass man die nun stärker benennt und damit an die Oberfläche holt und sichtbarer macht. Weil die Mehrheitsgesellschaft das nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Schon gar nicht in den öffentlichen Diskursen. Dann haben die marginalisierten Gruppen etwas mehr Selbstbewusstsein bekommen, sind aufgestanden, haben die Finger in die Wunden gelegt und dadurch wiederum hat sich eine Spaltung ergeben. Von Leuten, die sich dadurch getriggert gefühlt haben und das nicht wahrhaben wollten.
GORELIK: Die Rechten haben sich dazu extrem gut aufgestellt; das muss man leider auch sagen. Und zwar weltweit. Sie haben sich gegenseitig den Weg freigeschaufelt. Dadurch, dass beispielsweise in Polen über Abtreibung diskutiert wurde, haben sie das hier wieder aufgerufen, oder wenn Trump was macht, dann wird das von den Rechten in Europa gespiegelt und so weiter. Sie haben es geschafft, sich aus der sozialen Ächtung herauszuschaufeln. Heute kannst du problemlos in jeder Umfrage sagen, ich wähl die AfD. Sie sind aus der No-Go-Area raus und haben gute Strategien entwickelt.
OSMAN: Und trotzdem sind sie doch eine Minderheit.
GORELIK: Nein, das ist ein Viertel. Ich halte ein Viertel nicht für eine Minderheit.
OSMAN: Aber rein rechnerisch sind doch immer noch Dreiviertel dafür, für die Demokratie…
GORELIK: … es läuft zahlenmäßig fast auf eine Polarisierung hinaus inzwischen…
HEUSER: Das sehe ich auch so.
OSMAN: Ja, ich nehme es zurück, wenn man sich die Zahlen jetzt ansieht; da habt ihr völlig recht. Es ist tatsächlich wohl eine fifty-fifty-Situation. Wir müssen uns gerade deswegen aber trotzdem bewusstmachen, wie wichtig ein Zusammenschluss ist. Du hast es gerade gesagt, Lena: die Rechten haben sich weltweit vernetzt.
HEUSER: Bedeutet das nicht, dass wir im Grunde erstmalig wirklich offen, weil mit Blick auf die zuvor unter den Teppich gekehrten Wunden und Missstände über das reden, was gelebte Demokratie eigentlich sein soll? Sprich, ist die Stabilität der Demokratie möglicherweise auch lange Zeit durch Sillschweigen und Nivellieren von Differenzen erkauft worden? Besteht, positiv gesprochen, neben der Abgrenzung nach rechts, jetzt nicht auch die Chance, Demokratie gleichberechtigter und menschenfreundlicher zu schaffen?
Lena Gorelik © Gerald von Foris/Graf Verlag
GORELIK: Was wichtig ist, ist sich daran zu erinnern, was Demokratie schon immer war oder sein sollte: nämlich ein Aushandeln, ein Diskurs. Was uns, glaube ich, gerade am Meisten lähmt, ist diese Dichotomie, die Polarisierung, die wir als Status Quo annehmen. Und das ist eben leider etwas, was die Rechten vielleicht hergestellt haben, aber wir auch annehmen und übernehmen. Und dann gibt es eben überhaupt keinen Diskurs mehr. Mir fallen öffentlich keine Räume mehr ein, und ich meine wirklich: keine; mir fällt tatsächlich keine Institution ein, wo das noch möglich ist, wo Diskurs im ursprünglichen Sinne dieses Wortes wie ein „Durchwandeln“ praktiziert wird. Also nicht gegeneinander – wobei es auch das nicht mehr wirklich gibt, weil man sich ja gar nicht mehr zuhörend begegnet. Es gibt kein Ich-höre-zu-ich-erwidere; sondern nur noch ein Ich-schieße-dagegen. Die Realität ist doch: da sitzen die drei auf dem Podium, die dieser Meinung sind, und da drüben, da sitzen die, die anderer Meinung sind. Die ursprünglichen Mechanismen von Demokratie, zu denen Volksentscheid, auf die Straße gehen, Diskurs gehört, sich auseinandersetzen, streiten, zuhören, umdenken, miteinander denken, die sind uns verloren gegangen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Demokratie Arbeit ist, eine Arbeit, die von uns allen getan werden muss.
HEUSER: Wie schafft man diesen Raum denn aber zuallererst, was wir hier ja auch mit den deutsch-jüdischen Gesprächen, als einem Zuhören und Erwidern, anstreben? Ist die Kunst, ist die Literatur ein solcher Raum?
OSMAN: Ja. Aber nein auch. Weil die Kunst sich ja immer wieder selbst reproduziert. Wenn wir von einem Raum sprechen, den wir brauchen, um uns zu begegnen als gleichwertige Menschen auf einer Ebene, dann müssen wir einen Raum entwerfen. Jeder Raum hat Grenzen, hat eine Begrenzung. Sonst wäre er kein Raum. Auch ein metaphorischer Raum braucht Grenzen, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir die Grenzen des Sagbaren immer mehr nach rechts verschieben, dann haben wir den gesamten Raum im rechten Eck. Deswegen finde ich, dass wir uns zuallererst einmal klarmachen müssen, wo die Grenzen sind, innerhalb derer wir uns bewegen. Da müssen wir als Gesellschaft aufschreien, wenn wieder eine Konsensgrenze fällt. Wenn etwas klar rassistisch ist, aber als kontroverse Meinung geframt wird. Das ist keine politische Haltung, das ist Faschismus, was in den USA passiert: dieses Reframing zugunsten des rechtsradikalen Rahmens.
HEUSER: Nochmal nachgefragt, weil du eben gesagt hast, dass Kunst sich ja nur bedingt als Raum eignet. Literatur ist aber doch ein Raum, um dieses Reframing, das du hier ansprichst, ins kritische Narrativ zu holen, zu entlarven. Sie kann doch ein Achtsamkeitsraum sein, Diversität spiegeln und Visionen. Oder warum würdest du sagen, dass sich Literatur hier nicht eignet?
OSMAN: Weils total abgehoben ist. Das spielen wir uns nur gegenseitig den Ball zu. Das sieht man ja schon an der Sprache. Ich rede man wieder von der Tante G. von nebenan. Die kommt da nicht mit in diesem „Literaturhaus“.
GORELIK: Das glaube ich nicht. Natürlich ist Literatur oft abgehoben. Und trotzdem: es gibt unterschiedliche Literatur, es gibt unterschiedliche Zugänge. Vielleicht will ich auch dran glauben; ich will an die Kraft von Kunst glauben…
OSMAN: … ich auch.
GORELIK: Kunst im weitesten Sinne. Auch Filme. Ein gutes Beispiel ist Netflix. Diese ganzen Teenager-Serien, die mit einer Selbstverständlichkeit ihre Figuren queer und trans sein lassen. Wenn man die Jugendlichen und die Studien dazu anschaut, dann gehen sie mit diesen Begriffen mit einer Selbstverständlichkeit um, die es in meiner Generation nicht gab. Das ist auch der Verdienst von Netflix und Co. Nicht, weil jemand pädagogisch gesagt hat: es ist ganz wichtig, dass wir alle Sexualitäten gleichwertig annehmen, sondern weil sie eine Selbstverständlichkeit sehen, die sie übernehmen. Literatur und Kunst im weitesten Sinne hat jenseits vom Literaturhauspublikum eine Ausstrahlungskraft, die größer ist, als wir glauben. Ich jedenfalls brauche im Moment die Stärke von anderen Büchern. Menschen, die offen zum Beispiel darüber schreiben, was der Krieg in Israel und Gaza mit ihnen macht. Mir gibt eine solche Lesung eine Stärke, wie sonst lange nichts, sie hält mich aufrecht. Und vielleicht hält jemanden im Publikum mein Vortrag aufrecht, so. Wir geben einander Stärke.
HEUSER: Das ist ganz elementar. Wir lesen, um zu erfahren, dass wir nicht allein sind.
OSMAN: Natürlich glaube ich das auch. Sonst würde ich nicht schreiben, ganz klar. Und ich sehe auch, dass Kunst in jeder Form emotionalisiert. Das ist aber genau das, was ich meine, was uns gesellschaftlich fehlt: wir brauchen Narrative. Weil wir es immer mit Geschichten zu tun haben. Das ist das, was uns ausmacht. Wir definieren uns über Narrative, wir definieren aber auch die Anderen über Narrative. Unsere ganze Kultur und unser Selbstverständnis basiert immer auf Geschichten. Und die Faschisten haben das wahnsinnig gut verstanden. Die haben nämlich ein sehr kraftvolles Narrativ.
Und es verfängt deswegen so sehr, weil Angst, die Angst vor ‚Überfremdung‘ zum Beispiel, so ein starker Treiber ist. Weil Angst die stärkste Emotion ist. Und Geschichten funktionieren nur mit Emotionen. Sonst wären es keine Geschichten. Und wenn wir jetzt anfangen uns auf so einer intellektuellen Ebene mit Faktenchecks dagegenzustellen- so wichtig Fakten natürlich sind – damit allein ziehen wir den Kürzeren. Was wir nicht haben, ist ein wirksames Gegennarrativ.
GORELIK: Das stimmt. Aber deren Narrative sind ja sehr einfach. Es sind sehr simple Erzählungen, die sie uns aufgedrückt haben; in denen gibt es Gut und Böse, das funktioniert wie im Märchen. Wir müssen auch eine gute Erzählung finden. Ich glaube, das ist fatal. Und falsch. Umgekehrt: wir müssen Fakten und Bildung wieder interessant machen.
OSMAN: Ja, schon. Aber wie machen wir sie interessant? Indem sie wir sie erzählen.
GORELIK: Ich habe das Gefühl, wir reagieren nur, wir laufen [den Rechten] auch da hinterher. Reagieren [empört] auf deren Themensetzungen wie „Flüchtlinge sind böse“; wir übernehmen deren Mechanismen. Ich glaube, wir müssen anders denken. Wir müssen aus deren Denken hinaus; aus deren Dichotomien, wir müssen eigene Geschichten schaffen.
OSMAN: Aber das ist ja genau der Punkt. Da bin ich eben wieder bei der Vision. Unser Hirn ist ja evolutionsbiologisch dergestalt, dass wir Geschichten eher glauben als bloßen Daten, Zahlen, Fakten; weil Geschichten im limbischen System verarbeitet werden. Und Daten, Zahlen, Fakten im Frontallappen. Und wenn wir Geschichten hören, reagieren wir emotionaler und deswegen verfängt das mehr. Und wenn wir versuchen, diesen toxischen Narrativen einfach nur die nackten Zahlen aus Statistiken entgegenzuhalten, dann verliert man. Man merkt sich das nicht. Deswegen nochmal: wir brauchen eine Vision. Die muss ja gar nicht einfach und eindimensional sein. Aber wir brauchen eine, die genauso emotionalisiert. Und da rede ich jetzt nicht von ‚hell‘ gegen ‚dunkel‘ im Märchengewand. Sondern, das ist einfach etwas, das wir bewirken können und dass uns zeigt, wir nicht allein sind.
HEUSER: Aber da würde ich jetzt mal einhaken; wir haben doch diese Narrative. Um mit der Serie Adolescence mal bewusst ein Beispiel aus der Populärkultur zu nehmen; diese Serie hat tatsächlich politisch eingewirkt. Das englische Parlament hat, ausgelöst von deren intensiver Resonanz in der Bevölkerung, also in bewusster Replik auf die Auseinandersetzung mit dem Zusammenhängen von Gewalt und Sozial-Media-Framing, die in der Serie Thema sind, strengere Gesetze beschlossen. An den Schulen wurde intensiv über die Serie, in deren Fokus ein 13jähriger Mörder steht, diskutiert. Dies ist also ein Beispiel für ein gelungenes, differenziert-kritisches Narrativ, das eben auch Fakten und Erkenntnisse aus der Soziologie verarbeitet, das aber als hochemotionale packende Geschichte erzählt wird. Was deiner Argumentation, Joana, ja durchaus entgegenkommt. Meine Frage wäre: warum nehmen wir dieses Narrativ oder ähnliche Geschichten aber nicht als so machtvoll wahr, wie sie eigentlich doch sind?
OSMAN: Weil es heterogen ist. Heterogene Visionen [der Kunst] nehmen wir nicht als Einheit war.
GORELIK: Ich glaube, dass Heterogenität gerade gut ist. Die Rechten machen es eindimensional. Wir sollten mehrdimensional bleiben. Wir müssen mehr das sehen, was bereits da ist, was wie Blumen überall sprießt… Was aus meiner Erfahrung die größte Wirkung auf öffentlichen Diskussionsbühnen hat, ist nicht, wie fast immer vorgegeben, zum x-ten Mal über die Krise zu diskutieren, sondern stattdessen zum Beispiel gemeinsam öffentlich Gedichte zu lesen. Jeder bringt einen Text mit, der ihn anspricht, der etwas zur Lage, zu unserer Zeit, zu unseren Ängsten auf seine Art mitteilt. Da wirken und bewirken Worte etwas; es ist eine gemeinsame Erfahrung, sie zu hören.
OSMAN: Das ist genau das, was ich meine: Von der Schönheit der Heterogenität können und sollten wir erzählen.
HEUSER: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank euch beiden für das anregende Gespräch!