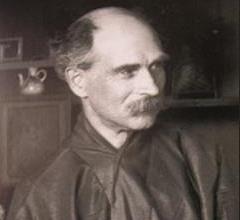Bayern und Japan (4): Japan und Japonismus in Europa – 1873: Japan-Ausstellung und Iwakura-Mission
Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.
*
I. Zur Entstehung des Japonismus in Europa
Die japanische Kunst bewegte stärker als alles andere die kunstliebenden Europäer. Trotz Japans Abschottung im 17. und 18. Jahrhundert war mittels der Niederlande dennoch weiter ein Kulturtransfer von Japan nach Europa erfolgt, insbesondere in Gestalt von Kunstobjekten. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Japan dann zu einem entscheidenden Faktor bei der Erneuerung des europäischen Kunstschaffens. Als nach Mitte des 19. Jahrhunderts durch einen Zufallsfund japanische Holzschnitte und Holzschnittbücher entdeckt wurden und französische Maler diese Kunst für sich gewannen, trat die japanische Kunst ihren Siegeszug durch Europa an. Der „Japonismus“ entstand und sollte in vielfältiger Weise fortan die Kunst Europas prägen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts würde er dazu führen, dass die moderne revolutionäre Kunstbewegung „Art Nouveau“ entstehen sollte und 1896 in München seine deutsche Variante: der einzigartige Jugendstil.
Paris – Entdeckung: Japanische Holzschnitte – Weltausstellung 1867
Um 1860 fielen japanische Holzschnitte als Einschlagpapier für Exportporzellan zufällig dem französischen Graphiker Felix Braquemond (1833-1914) in Paris die Hände. Er beschaffte sich das Skizzenbuch von Hokusai und zeigte es begeistert herum. 1867 erlebte die japanische Holzschnittkunst auf der Weltausstellung in Paris einen triumphalen Erfolg. Der Schriftsteller Philippe Burty (1830-1890) produzierte eine Artikelserie, die dem neuen Modetrend ihren Namen gab: „Japonisme“. Wenig später besaßen viele Künstler, darunter Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin und andere, ihre eigenen Sammlungen, deren Sujets sie in ihren Bildern verwendeten und deren Stil sie nachahmten.
Von Paris als tonangebender Stadt der Mode und des eleganten Lebensstils strahlte der Japonismus in andere Hauptstädte und Länder aus, nach Wien und auch nach München. Eine wichtige Rolle für die Netzwerke zwischen den Metropolen sowie zwischen Europa und Japan spielten dabei zwei große Kunsthändler in Paris: der Japaner Hayashi Tadamasa (1853-1906) und der Deutsche Siegfried Bing (1838-1905). Bing, der jüdischer Herkunft war, stammte aus Hamburg. Darüber hinaus trugen zahllose Geschäfte und Läden, die auf der Woge des neuen Japan-Trends mitritten, zu dieser Vernetzung bei.
Links: Siegfried Bing. Rechts: Hayashi Tadamasa.
Wien, 1873: Weltausstellung Japan
In Europa präsentiert wurde Japan erstmals 1873 auf der Weltausstellung in Wien. Hier konnte das Publikum damals auch den ersten japanischen Garten sehen. Fast alle Ausstellungsobjekte wurden verkauft. In den Folgejahren musste alles „japanisch“ gestaltet sein.
II. München mit japanischen Augen gesehen: Iwakura-Mission 1872/73
Seit 1853 hatten die USA in Zusammenhang mit dem Walfischfang Japan gezwungen, die Abschottung aufzugeben. 1872/1873 erfolgte die sog. „Iwakura-Mission“ über die USA in die Hauptstädte Europas, die arabische Halbinsel, Südostasien, zurück nach Japan. Die Gesandtschaft – Männer, die später auch die Meiji-Restauration durchführten – wurde nach dem Leiter der Mission Fürst Iwakura Tomomi (1825-1883), einem Hofadligen aus dem Umkreis des jungen Kaisers in Kyoto, benannt. Der Historiker Kume Kunitake begleitete als Sekretär die kaiserliche Gesandtschaft auf ihrer Reise durch zwölf Staaten. Die Reise der Japaner wurde für die USA, die als wichtigster Handelspartner die alten europäischen Staaten abgelöst hatten, ein Triumph.
Fürst Iwakura Tomomi (Mitte) 1872 in San Francisco mit vier Gesandten
1873 – Iwakura-Mission in München
Nach München kam die Iwakura-Mission nur, weil sie 1873 nach Wien zur Weltausstellung wollte, wo Japan erstmals als Nation präsentiert worden war. Auch viele Münchner lernten Japan hier erstmals kennen. Am 5. Mai 1873 konnte man in den Münchner Neuesten Nachrichten dann lesen: „Die kaiserlichen japanischen Gesandten […] sind in München eingetroffen und im Gasthof Zu den Vier Jahreszeiten abgestiegen.“
Erster japanischer Bericht über München
Kumes München-Bericht stellt die erste Beschreibung der bayerischen Landeshauptstadt aus japanischer Sicht dar. In München war für die Japaner ein rein touristisches Programm angesagt. In seinem Bericht hielt Kume u.a. fest, die Sommer seien dort brennend heiß.
Besonders gut gefiel den Besuchern die Königliche Residenz. Kume war erstaunt, dass diese der Allgemeinheit zugänglich war: „An der Rückseite [der Residenz] schließt an das Gebäude ein großer Garten an… Dort werden Getränke zum Kaufe angeboten. Auch die Besichtigung des Königshofes selbst ist der Allgemeinheit freigestellt.“ Dass der Hofgarten und auch die Innenhöfe des Königshofes für das Publikum geöffnet waren, hob Kume wohl besonders deshalb hervor, weil dies für Japaner ungewöhnlich war. Es wäre nie möglich gewesen, dass ein japanischer Bürger im Kaiserpalast oder in den umgebenden Gärten spazieren gegangen wäre.
Kume lieferte auch eine Beschreibung der Gebäude, die die berühmten Gemäldesammlungen Münchens beherbergten, und staunte über die Pracht und Großartigkeit der Gebäude. Dergleichen kannte man im Erdbeben geplagten Japan damals noch nicht. Später errichteten deutsche Baumeister gleichartige Gebäude auch in Japan. Einige davon gibt es heute noch. Die Neue Pinakothek fand Kume baulich nicht so gut gelungen. Er war aber von ihrer Bedeutung beeindruckt, da sie seinerzeit das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst war. Er beschrieb ebenfalls den Englischen Garten und den Chinesischen Turm. Fasziniert war er vor allem von der Bavaria. Sein Fazit: „In Europa befindet sich keine vergleichbare Statue.“
Konzert zum Oktoberfest vor der Bavaria, Foto: Robert Hertz (München Tourismus)
Auch wenn Japaner mit großen Statuen selbst Erfahrung hatten – der Buddha in Kamakura ist das größte Bronzedenkmal der Welt –, muss es sie auf das Höchste verwundert haben, dass die Baiern „einer weiblichen Gottheit“ eine Statue widmeten. Wie beeindruckt sie von der Bavaria waren, geht aus Kumes Bericht hervor:
Nach rechts schweift der Blick auf Berge, davor pulsiert die geschäftige Innenstadt. Die Aussicht ist außerordentlich entzückend. Eben hier erhebt sich eine kolossale Bronzestatue. Diese Statue einer weiblichen Gottheit hält mit der linken Hand einen Kranz aus Zweigen über ihren Kopf, in der Rechten trägt sie ein Schwert, das sie über einen Löwen hebt. Sie stellt die Schutzgottheit dieses Landes dar. Der Steinsockel, auf dem die Skulptur steht, ist mehr als 30 Fuß hoch. Das Gewicht liegt bei 80 Tonnen. Die Figur ist innen hohl, so daß sie für Besucher vom Fuß des Sockels über eine Wendeltreppe bis nach oben zu begehen ist. Für den Aufstieg gibt die Aufsicht Kerzen aus, und mit der Kerze in der Hand steigt man die Treppe hoch. Um zur Spitze vorzudringen, sind im Fundament 65 Stufen zu erklimmen, dann folgen nochmals 60 Stufen, bis man in den Nacken der Statue gelangt. Auf beiden Seiten des Gesichts sind Sitzgelegenheiten aufgestellt, auf die sogar mehr als sechs Leute passen. Die Größe des Halses ist derart, daß selbst hochgewachsene Menschen ihren Kopf nicht beugen müssen. Durch die Mundöffnung und die Augen fällt Licht herein. Die ganze Stadt ist von hier zu überblicken. Die ausgestreckte linke Hand, die man hier sieht, wirkt wie ein alter, ausladender Baum. In Europa findet sich keine weitere vergleichbare Statue.
Dass Kume nicht über das Münchner Bier schrieb, legt nahe, dass die Japaner wohl kein Bier probiert hatten. Und auch die Schlösser König Ludwigs II. gab es damals noch nicht. Vieles aus Kumes Bericht wurde später zum Pflichtbesichtigungsprogramm für japanische Wissenschaftler und Studenten, die nach München kamen.
Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
Bayern und Japan (4): Japan und Japonismus in Europa – 1873: Japan-Ausstellung und Iwakura-Mission
Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.
*
I. Zur Entstehung des Japonismus in Europa
Die japanische Kunst bewegte stärker als alles andere die kunstliebenden Europäer. Trotz Japans Abschottung im 17. und 18. Jahrhundert war mittels der Niederlande dennoch weiter ein Kulturtransfer von Japan nach Europa erfolgt, insbesondere in Gestalt von Kunstobjekten. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Japan dann zu einem entscheidenden Faktor bei der Erneuerung des europäischen Kunstschaffens. Als nach Mitte des 19. Jahrhunderts durch einen Zufallsfund japanische Holzschnitte und Holzschnittbücher entdeckt wurden und französische Maler diese Kunst für sich gewannen, trat die japanische Kunst ihren Siegeszug durch Europa an. Der „Japonismus“ entstand und sollte in vielfältiger Weise fortan die Kunst Europas prägen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts würde er dazu führen, dass die moderne revolutionäre Kunstbewegung „Art Nouveau“ entstehen sollte und 1896 in München seine deutsche Variante: der einzigartige Jugendstil.
Paris – Entdeckung: Japanische Holzschnitte – Weltausstellung 1867
Um 1860 fielen japanische Holzschnitte als Einschlagpapier für Exportporzellan zufällig dem französischen Graphiker Felix Braquemond (1833-1914) in Paris die Hände. Er beschaffte sich das Skizzenbuch von Hokusai und zeigte es begeistert herum. 1867 erlebte die japanische Holzschnittkunst auf der Weltausstellung in Paris einen triumphalen Erfolg. Der Schriftsteller Philippe Burty (1830-1890) produzierte eine Artikelserie, die dem neuen Modetrend ihren Namen gab: „Japonisme“. Wenig später besaßen viele Künstler, darunter Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin und andere, ihre eigenen Sammlungen, deren Sujets sie in ihren Bildern verwendeten und deren Stil sie nachahmten.
Von Paris als tonangebender Stadt der Mode und des eleganten Lebensstils strahlte der Japonismus in andere Hauptstädte und Länder aus, nach Wien und auch nach München. Eine wichtige Rolle für die Netzwerke zwischen den Metropolen sowie zwischen Europa und Japan spielten dabei zwei große Kunsthändler in Paris: der Japaner Hayashi Tadamasa (1853-1906) und der Deutsche Siegfried Bing (1838-1905). Bing, der jüdischer Herkunft war, stammte aus Hamburg. Darüber hinaus trugen zahllose Geschäfte und Läden, die auf der Woge des neuen Japan-Trends mitritten, zu dieser Vernetzung bei.
Links: Siegfried Bing. Rechts: Hayashi Tadamasa.
Wien, 1873: Weltausstellung Japan
In Europa präsentiert wurde Japan erstmals 1873 auf der Weltausstellung in Wien. Hier konnte das Publikum damals auch den ersten japanischen Garten sehen. Fast alle Ausstellungsobjekte wurden verkauft. In den Folgejahren musste alles „japanisch“ gestaltet sein.
II. München mit japanischen Augen gesehen: Iwakura-Mission 1872/73
Seit 1853 hatten die USA in Zusammenhang mit dem Walfischfang Japan gezwungen, die Abschottung aufzugeben. 1872/1873 erfolgte die sog. „Iwakura-Mission“ über die USA in die Hauptstädte Europas, die arabische Halbinsel, Südostasien, zurück nach Japan. Die Gesandtschaft – Männer, die später auch die Meiji-Restauration durchführten – wurde nach dem Leiter der Mission Fürst Iwakura Tomomi (1825-1883), einem Hofadligen aus dem Umkreis des jungen Kaisers in Kyoto, benannt. Der Historiker Kume Kunitake begleitete als Sekretär die kaiserliche Gesandtschaft auf ihrer Reise durch zwölf Staaten. Die Reise der Japaner wurde für die USA, die als wichtigster Handelspartner die alten europäischen Staaten abgelöst hatten, ein Triumph.
Fürst Iwakura Tomomi (Mitte) 1872 in San Francisco mit vier Gesandten
1873 – Iwakura-Mission in München
Nach München kam die Iwakura-Mission nur, weil sie 1873 nach Wien zur Weltausstellung wollte, wo Japan erstmals als Nation präsentiert worden war. Auch viele Münchner lernten Japan hier erstmals kennen. Am 5. Mai 1873 konnte man in den Münchner Neuesten Nachrichten dann lesen: „Die kaiserlichen japanischen Gesandten […] sind in München eingetroffen und im Gasthof Zu den Vier Jahreszeiten abgestiegen.“
Erster japanischer Bericht über München
Kumes München-Bericht stellt die erste Beschreibung der bayerischen Landeshauptstadt aus japanischer Sicht dar. In München war für die Japaner ein rein touristisches Programm angesagt. In seinem Bericht hielt Kume u.a. fest, die Sommer seien dort brennend heiß.
Besonders gut gefiel den Besuchern die Königliche Residenz. Kume war erstaunt, dass diese der Allgemeinheit zugänglich war: „An der Rückseite [der Residenz] schließt an das Gebäude ein großer Garten an… Dort werden Getränke zum Kaufe angeboten. Auch die Besichtigung des Königshofes selbst ist der Allgemeinheit freigestellt.“ Dass der Hofgarten und auch die Innenhöfe des Königshofes für das Publikum geöffnet waren, hob Kume wohl besonders deshalb hervor, weil dies für Japaner ungewöhnlich war. Es wäre nie möglich gewesen, dass ein japanischer Bürger im Kaiserpalast oder in den umgebenden Gärten spazieren gegangen wäre.
Kume lieferte auch eine Beschreibung der Gebäude, die die berühmten Gemäldesammlungen Münchens beherbergten, und staunte über die Pracht und Großartigkeit der Gebäude. Dergleichen kannte man im Erdbeben geplagten Japan damals noch nicht. Später errichteten deutsche Baumeister gleichartige Gebäude auch in Japan. Einige davon gibt es heute noch. Die Neue Pinakothek fand Kume baulich nicht so gut gelungen. Er war aber von ihrer Bedeutung beeindruckt, da sie seinerzeit das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst war. Er beschrieb ebenfalls den Englischen Garten und den Chinesischen Turm. Fasziniert war er vor allem von der Bavaria. Sein Fazit: „In Europa befindet sich keine vergleichbare Statue.“
Konzert zum Oktoberfest vor der Bavaria, Foto: Robert Hertz (München Tourismus)
Auch wenn Japaner mit großen Statuen selbst Erfahrung hatten – der Buddha in Kamakura ist das größte Bronzedenkmal der Welt –, muss es sie auf das Höchste verwundert haben, dass die Baiern „einer weiblichen Gottheit“ eine Statue widmeten. Wie beeindruckt sie von der Bavaria waren, geht aus Kumes Bericht hervor:
Nach rechts schweift der Blick auf Berge, davor pulsiert die geschäftige Innenstadt. Die Aussicht ist außerordentlich entzückend. Eben hier erhebt sich eine kolossale Bronzestatue. Diese Statue einer weiblichen Gottheit hält mit der linken Hand einen Kranz aus Zweigen über ihren Kopf, in der Rechten trägt sie ein Schwert, das sie über einen Löwen hebt. Sie stellt die Schutzgottheit dieses Landes dar. Der Steinsockel, auf dem die Skulptur steht, ist mehr als 30 Fuß hoch. Das Gewicht liegt bei 80 Tonnen. Die Figur ist innen hohl, so daß sie für Besucher vom Fuß des Sockels über eine Wendeltreppe bis nach oben zu begehen ist. Für den Aufstieg gibt die Aufsicht Kerzen aus, und mit der Kerze in der Hand steigt man die Treppe hoch. Um zur Spitze vorzudringen, sind im Fundament 65 Stufen zu erklimmen, dann folgen nochmals 60 Stufen, bis man in den Nacken der Statue gelangt. Auf beiden Seiten des Gesichts sind Sitzgelegenheiten aufgestellt, auf die sogar mehr als sechs Leute passen. Die Größe des Halses ist derart, daß selbst hochgewachsene Menschen ihren Kopf nicht beugen müssen. Durch die Mundöffnung und die Augen fällt Licht herein. Die ganze Stadt ist von hier zu überblicken. Die ausgestreckte linke Hand, die man hier sieht, wirkt wie ein alter, ausladender Baum. In Europa findet sich keine weitere vergleichbare Statue.
Dass Kume nicht über das Münchner Bier schrieb, legt nahe, dass die Japaner wohl kein Bier probiert hatten. Und auch die Schlösser König Ludwigs II. gab es damals noch nicht. Vieles aus Kumes Bericht wurde später zum Pflichtbesichtigungsprogramm für japanische Wissenschaftler und Studenten, die nach München kamen.
Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.