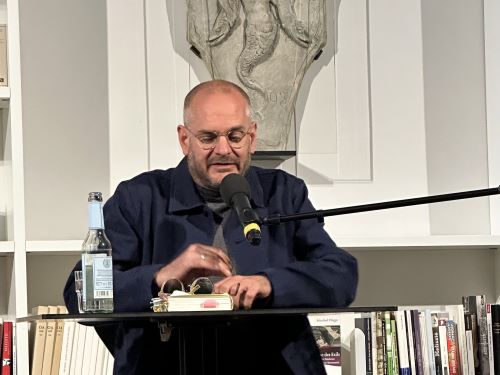Das Zentrum für Gegenwartsliteratur München stellt sich vor
Am 8. Mai 2025 lud das Zentrum für Gegenwartsliteratur München zur Veranstaltung „Am Schnittpunkt“ in die Monacensia im Hildebrandhaus ein. Das ZfGM, das „die Forschung zur Gegenwartsliteratur in einen Dialog mit der Literatur“ bringt und so „Theorie und Praxis“ verbindet, präsentierte seine bisherige Arbeit an diesem Abend der Öffentlichkeit. Lebhafte Diskussionen und eine exklusive Lesung vervollständigten die gelungene Veranstaltung.
*
Das Zentrum für Gegenwartsliteratur München, das 2024 seine Arbeit aufnahm, befindet sich am Schnittpunkt zwischen Gegenwartsliteratur und Literaturwissenschaft. Die Begegnung der beiden Felder gestaltete sich an diesem Abend sehr sanft. Der Veranstaltungsraum in der Monacensia war warm und hell und unterstrich die gegenseitige Zuneigung der Anwesenden, die hier so deutlich spürbar wurde. Wie auch die Liebe zur Literatur und zur ihr gewidmeten Forschung, die alle an diesem Abend vereinte.
Die Eröffnungsrede
Eigentlich ist die Idee eines Austauschs von Gegenwartsliteratur und Literaturwissenschaft, zwischen Autorinnen und Autoren sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht besonders abwegig. Das betonte auch Prof. Frieder von Ammon, Vorstand des ZfGM, in seiner lebhaften und liebevollen Begrüßungsrede. Dass ein wirklich produktiver Austausch, besonders in einem akademischen Kontext, dennoch oft mit Verachtung gestraft wird und somit viel zu kurz kommt, wird an der langen Entstehungsphase des Zentrums für Gegenwartsliteratur München klar. Noch während er die Professur für Neuere deutsche Literatur in Leipzig innehatte, versuchte von Ammon seine Idee dort in die Tat umzusetzen. Doch erst als er 2022 an die LMU zurückkehrte, wurde das Projekt realisiert. Vor knapp einem Jahr feierte das ZfGM dann mit einer Veranstaltung in der Monacensia seine Gründung. Mit einem ersten Resümée der Arbeit des Zentrums schloss sich an diesem Abend nun der Kreis.
Frieder von Ammon bei der Eröffnungsrede © privat
In seiner Rede blickte Frieder von Ammon auch auf die Zeit vor der Gründung des Zentrums zurück. Er betonte die Herausforderungen, Schwierigkeiten und zukünftigen Aufgabenfelder, doch die Freude über die Zukunft und die Potentiale des ZfGM herrschte vor. Die Gäste erfuhren außerdem von den bereits etablierten und erprobten Formaten, wie dem „Forum“, den Reihen „W:ortwechsel“ und „andererseits“, die das ZfGM mit Stolz erfüllen.
Seinen aufrichtigen Dank richtete der Redner an die erste Geschäftsführerin des ZfGM Nora Zapf, den aktuellen Geschäftsführer Dr. Kay Wolfinger, die Gastgeberin Anke Buettner und viele andere Mitglieder und Freunde des ZfGM sowie an ein „Ministerium mit offenen Ohren“ – das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst –, das an diesem Abend durch Dr. Elisabeth Donoughue vertreten war.
Zuletzt formulierte Frieder von Ammon in drei Punkten die Programmatik des ZfGM. So hat sich das Zentrum zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Forschungs- und Lehrvorgänge über die Grenzen der Fächer hinweg zusammenzuführen. Denn – und darüber waren sich an diesem Abend wohl alle einig – die monopolistischen Ansprüche einzelner Disziplinen sind nicht mehr zeitgemäß. Zweitens vertritt das ZfGM die Auffassung, dass ein Austausch zwischen Gegenwartsliteratur und Wissenschaft besonders fruchtbar ist. Und dass dabei die Literaturwissenschaft von dem spezifischen Wissen der Literatur profitieren kann. Zuletzt hat sich das ZfGM zur Aufgabe gemacht, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu suchen und herzustellen.
Die Podiumsdiskussion
Um Öffentlichkeit und die Frage der Zugänglichkeit von Literatur ging es auch zu Beginn der Podiumsdiskussion, im zweiten Teil des Abends. Buchwissenschaftlerin und Vorstandsmitglied des ZfGM, Erika Thomalla, moderierte auf der Bühne die Diskussion. Neben ihr saßen Anke Buettner (Direktorin der Monacensia), Marie Schmidt (Kultur- und Literaturredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung) und Florian Kessler (Lektor beim Hanser Verlag).
Die Diskussion war nicht nur von der Freude am Austausch geprägt, sondern auch von dem Wunsch nach Erkenntnisgewinn getrieben. Es war erfrischend zu beobachten, dass das ZfGM diese Diskussion nutzte, um relevante und unbeantwortete Fragen des Projekts zu problematisieren und nach Lösungsansätzen zu suchen.
So formulierte Florian Kessler das Desiderat, auch junge Menschen in niedrigschwelliger Weise zu erreichen. Im direkten Anschluss ging es um die Frage, ob es überhaupt wirklich offene Räume gibt, ob gerade ein Raum im Untergeschoss des Hintergebäudes in der Schellingstraße 3, in der das „Forum“ des ZfGM derzeit stattfindet, wirklich als offener Raum bezeichnet werden kann. Ebenso kreiste die weitere Diskussion um Fragen der Zugänglichkeit bzw. Exklusivität von Literatur, um verschiedene Zielgruppen und Spezialöffentlichkeiten, besonders auch in der Verlags- und Zeitungswelt. Lange Schlangen auf den Buchmessen bilden sich mit Vorliebe an den Ständen so mancher generischer Romantasy-Bücher. Somit spielen auch sie in der Gegenwartsliteratur eine Rolle. Auffällig war dennoch, dass bei all den ausführlichen Gesprächen über Zugänglichkeit für alle, eben vielleicht doch nicht wirklich alle gemeint waren.
Interessanterweise forderte Florian Kessler in diesem Kontext, dass es eine Akademie braucht, die vorsätzlich und bewusst exklusiv ist. Denn er sah die Gefahr einer zu starken Meinungsangleichung, eines zu freundschaftlichen Diskurses. Dieser droht sich selbst die Diskussionsgrundlage zu nehmen, wenn im Prinzip alle der gleichen Meinung sind. Die verschiedenen Bereiche, die einzelnen Fächer und Positionen sollen bestehen bleiben. Es muss auch auf Konflikten beharrt werden, um ein Gespräch am Leben zu erhalten.
Marie Schmidt diagnostizierte darüber hinaus ein wachsendes Bedürfnis der Menschen, wirklich miteinander zu reden. Es wurde über den ökonomischen Druck gesprochen, der auf Verlagsprogrammen und Kulturjournalismus lastet, über die Beschleunigung des Marktes und die Tatsache, dass Diskurse immer kurzlebiger werden und von der Bildfläche genauso schnell verschwinden wie sie erscheinen.
In der Pause gewann die sorglose Atmosphäre des Hildebrandhauses wieder die Oberhand, und Freigetränke sorgten für angenehme und lebhafte Gespräche unter den Gästen und Veranstaltern.
Lesung von Jonas Lüscher
Inzwischen war es vor den großen Fenstern des Saales dunkel geworden. Eine spätabendliche Stimmung begleitete nun den letzten Teil des Abends. Verzauberte Vorbestimmung heißt der 2025 erschienene Roman von Jonas Lüscher, der mit viel Überzeugung von Rebecca Faber vorgestellt wurde. Sie sprach von verschiedenen Zeitebenen und Episoden im Text, die miteinander verknüpft und verwoben werden, von Figuren und historischen Momenten, mit denen der Autor in ihren Worten „häkelt“. Wie Schlaufen legen sich die einzelnen narrativen Elemente ineinander und bilden so ein vielschichtiges Werk.
Die Stimme Jonas Lüschers erfüllte im Anschluss den Raum, der sonst vermutlich von bereits etwas erschöpftem und betretenem Schweigen erfüllt gewesen wäre. Betreten über die Schwere der vorgetragenen Textstelle, die nun doch an das historisch aufgeladene Datum, den 8. Mai, erinnerte. Der vorgetragene Buchabschnitt enthält die detaillierte Wiedergabe einer auf einem Todesmarsch nach Theresienstadt geführten Liste, die Namen und Staatsangehörigkeiten der an den Tagen des Marsches verstorbenen Häftlinge verzeichnet. Die explizite Nennung der Namen der Opfer der letzten Kriegstage stand im Kontrast zu den vielen Namenlosen, die ihrer Identität beraubt, einzig als „ein namenloser Franzose“ oder „ein namenloser Pole“ aufgeführt wurden.
Jonas Lüscher liest aus Verzauberte Vorbestimmung © Tanja Praske, Monacensia
Abschließend sprach Frieder von Ammon mit Jonas Lüscher über den Roman und dessen Bezug zur Literaturwissenschaft. Der Literaturwissenschaftler lobte den Text in den höchsten Tönen, betonte die rhythmische Eleganz und Wucht sowie eine Sättigung an Wissen und Tradition, die er beim Lesen wahrnimmt. Die Diskussion drehte sich des Weiteren um den Autor Peter Weiss, der als Figur im Roman wiederzufinden ist und die Handlung mitbegleitet. Auch über die Betitelung des Buchs als „Covid-19-Roman“ (so Sigrid Löffler im Falter, 19.02.25) sprachen die beiden auf der Bühne: In seinem Buch verarbeitete der Autor u.a. die Erfahrung einer künstlichen Beatmung, die er während eines Komas in der Corona-Pandemie machte. Jonas Lüscher erwähnte an dieser Stelle seine Schwierigkeiten mit dem autofiktionalen Schreiben und die Herausforderung, rückblickend einen komatösen Daseinszustand zu beschreiben.
Jonas Lüscher und Frieder von Ammon in abschließender Diskussion © privat
Die Themen des Abends schienen beinahe unerschöpflich, doch musste er zu seinem Ende kommen. Mit einigen Worten aus Verzauberte Vorbestimmung entließ Jonas Lüscher das Publikum in das nächtliche München – voller Zuversicht für die zauberhafte Zukunft des Zentrums für Gegenwartsliteratur.
Das Zentrum für Gegenwartsliteratur München stellt sich vor
Am 8. Mai 2025 lud das Zentrum für Gegenwartsliteratur München zur Veranstaltung „Am Schnittpunkt“ in die Monacensia im Hildebrandhaus ein. Das ZfGM, das „die Forschung zur Gegenwartsliteratur in einen Dialog mit der Literatur“ bringt und so „Theorie und Praxis“ verbindet, präsentierte seine bisherige Arbeit an diesem Abend der Öffentlichkeit. Lebhafte Diskussionen und eine exklusive Lesung vervollständigten die gelungene Veranstaltung.
*
Das Zentrum für Gegenwartsliteratur München, das 2024 seine Arbeit aufnahm, befindet sich am Schnittpunkt zwischen Gegenwartsliteratur und Literaturwissenschaft. Die Begegnung der beiden Felder gestaltete sich an diesem Abend sehr sanft. Der Veranstaltungsraum in der Monacensia war warm und hell und unterstrich die gegenseitige Zuneigung der Anwesenden, die hier so deutlich spürbar wurde. Wie auch die Liebe zur Literatur und zur ihr gewidmeten Forschung, die alle an diesem Abend vereinte.
Die Eröffnungsrede
Eigentlich ist die Idee eines Austauschs von Gegenwartsliteratur und Literaturwissenschaft, zwischen Autorinnen und Autoren sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht besonders abwegig. Das betonte auch Prof. Frieder von Ammon, Vorstand des ZfGM, in seiner lebhaften und liebevollen Begrüßungsrede. Dass ein wirklich produktiver Austausch, besonders in einem akademischen Kontext, dennoch oft mit Verachtung gestraft wird und somit viel zu kurz kommt, wird an der langen Entstehungsphase des Zentrums für Gegenwartsliteratur München klar. Noch während er die Professur für Neuere deutsche Literatur in Leipzig innehatte, versuchte von Ammon seine Idee dort in die Tat umzusetzen. Doch erst als er 2022 an die LMU zurückkehrte, wurde das Projekt realisiert. Vor knapp einem Jahr feierte das ZfGM dann mit einer Veranstaltung in der Monacensia seine Gründung. Mit einem ersten Resümée der Arbeit des Zentrums schloss sich an diesem Abend nun der Kreis.
Frieder von Ammon bei der Eröffnungsrede © privat
In seiner Rede blickte Frieder von Ammon auch auf die Zeit vor der Gründung des Zentrums zurück. Er betonte die Herausforderungen, Schwierigkeiten und zukünftigen Aufgabenfelder, doch die Freude über die Zukunft und die Potentiale des ZfGM herrschte vor. Die Gäste erfuhren außerdem von den bereits etablierten und erprobten Formaten, wie dem „Forum“, den Reihen „W:ortwechsel“ und „andererseits“, die das ZfGM mit Stolz erfüllen.
Seinen aufrichtigen Dank richtete der Redner an die erste Geschäftsführerin des ZfGM Nora Zapf, den aktuellen Geschäftsführer Dr. Kay Wolfinger, die Gastgeberin Anke Buettner und viele andere Mitglieder und Freunde des ZfGM sowie an ein „Ministerium mit offenen Ohren“ – das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst –, das an diesem Abend durch Dr. Elisabeth Donoughue vertreten war.
Zuletzt formulierte Frieder von Ammon in drei Punkten die Programmatik des ZfGM. So hat sich das Zentrum zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Forschungs- und Lehrvorgänge über die Grenzen der Fächer hinweg zusammenzuführen. Denn – und darüber waren sich an diesem Abend wohl alle einig – die monopolistischen Ansprüche einzelner Disziplinen sind nicht mehr zeitgemäß. Zweitens vertritt das ZfGM die Auffassung, dass ein Austausch zwischen Gegenwartsliteratur und Wissenschaft besonders fruchtbar ist. Und dass dabei die Literaturwissenschaft von dem spezifischen Wissen der Literatur profitieren kann. Zuletzt hat sich das ZfGM zur Aufgabe gemacht, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu suchen und herzustellen.
Die Podiumsdiskussion
Um Öffentlichkeit und die Frage der Zugänglichkeit von Literatur ging es auch zu Beginn der Podiumsdiskussion, im zweiten Teil des Abends. Buchwissenschaftlerin und Vorstandsmitglied des ZfGM, Erika Thomalla, moderierte auf der Bühne die Diskussion. Neben ihr saßen Anke Buettner (Direktorin der Monacensia), Marie Schmidt (Kultur- und Literaturredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung) und Florian Kessler (Lektor beim Hanser Verlag).
Die Diskussion war nicht nur von der Freude am Austausch geprägt, sondern auch von dem Wunsch nach Erkenntnisgewinn getrieben. Es war erfrischend zu beobachten, dass das ZfGM diese Diskussion nutzte, um relevante und unbeantwortete Fragen des Projekts zu problematisieren und nach Lösungsansätzen zu suchen.
So formulierte Florian Kessler das Desiderat, auch junge Menschen in niedrigschwelliger Weise zu erreichen. Im direkten Anschluss ging es um die Frage, ob es überhaupt wirklich offene Räume gibt, ob gerade ein Raum im Untergeschoss des Hintergebäudes in der Schellingstraße 3, in der das „Forum“ des ZfGM derzeit stattfindet, wirklich als offener Raum bezeichnet werden kann. Ebenso kreiste die weitere Diskussion um Fragen der Zugänglichkeit bzw. Exklusivität von Literatur, um verschiedene Zielgruppen und Spezialöffentlichkeiten, besonders auch in der Verlags- und Zeitungswelt. Lange Schlangen auf den Buchmessen bilden sich mit Vorliebe an den Ständen so mancher generischer Romantasy-Bücher. Somit spielen auch sie in der Gegenwartsliteratur eine Rolle. Auffällig war dennoch, dass bei all den ausführlichen Gesprächen über Zugänglichkeit für alle, eben vielleicht doch nicht wirklich alle gemeint waren.
Interessanterweise forderte Florian Kessler in diesem Kontext, dass es eine Akademie braucht, die vorsätzlich und bewusst exklusiv ist. Denn er sah die Gefahr einer zu starken Meinungsangleichung, eines zu freundschaftlichen Diskurses. Dieser droht sich selbst die Diskussionsgrundlage zu nehmen, wenn im Prinzip alle der gleichen Meinung sind. Die verschiedenen Bereiche, die einzelnen Fächer und Positionen sollen bestehen bleiben. Es muss auch auf Konflikten beharrt werden, um ein Gespräch am Leben zu erhalten.
Marie Schmidt diagnostizierte darüber hinaus ein wachsendes Bedürfnis der Menschen, wirklich miteinander zu reden. Es wurde über den ökonomischen Druck gesprochen, der auf Verlagsprogrammen und Kulturjournalismus lastet, über die Beschleunigung des Marktes und die Tatsache, dass Diskurse immer kurzlebiger werden und von der Bildfläche genauso schnell verschwinden wie sie erscheinen.
In der Pause gewann die sorglose Atmosphäre des Hildebrandhauses wieder die Oberhand, und Freigetränke sorgten für angenehme und lebhafte Gespräche unter den Gästen und Veranstaltern.
Lesung von Jonas Lüscher
Inzwischen war es vor den großen Fenstern des Saales dunkel geworden. Eine spätabendliche Stimmung begleitete nun den letzten Teil des Abends. Verzauberte Vorbestimmung heißt der 2025 erschienene Roman von Jonas Lüscher, der mit viel Überzeugung von Rebecca Faber vorgestellt wurde. Sie sprach von verschiedenen Zeitebenen und Episoden im Text, die miteinander verknüpft und verwoben werden, von Figuren und historischen Momenten, mit denen der Autor in ihren Worten „häkelt“. Wie Schlaufen legen sich die einzelnen narrativen Elemente ineinander und bilden so ein vielschichtiges Werk.
Die Stimme Jonas Lüschers erfüllte im Anschluss den Raum, der sonst vermutlich von bereits etwas erschöpftem und betretenem Schweigen erfüllt gewesen wäre. Betreten über die Schwere der vorgetragenen Textstelle, die nun doch an das historisch aufgeladene Datum, den 8. Mai, erinnerte. Der vorgetragene Buchabschnitt enthält die detaillierte Wiedergabe einer auf einem Todesmarsch nach Theresienstadt geführten Liste, die Namen und Staatsangehörigkeiten der an den Tagen des Marsches verstorbenen Häftlinge verzeichnet. Die explizite Nennung der Namen der Opfer der letzten Kriegstage stand im Kontrast zu den vielen Namenlosen, die ihrer Identität beraubt, einzig als „ein namenloser Franzose“ oder „ein namenloser Pole“ aufgeführt wurden.
Jonas Lüscher liest aus Verzauberte Vorbestimmung © Tanja Praske, Monacensia
Abschließend sprach Frieder von Ammon mit Jonas Lüscher über den Roman und dessen Bezug zur Literaturwissenschaft. Der Literaturwissenschaftler lobte den Text in den höchsten Tönen, betonte die rhythmische Eleganz und Wucht sowie eine Sättigung an Wissen und Tradition, die er beim Lesen wahrnimmt. Die Diskussion drehte sich des Weiteren um den Autor Peter Weiss, der als Figur im Roman wiederzufinden ist und die Handlung mitbegleitet. Auch über die Betitelung des Buchs als „Covid-19-Roman“ (so Sigrid Löffler im Falter, 19.02.25) sprachen die beiden auf der Bühne: In seinem Buch verarbeitete der Autor u.a. die Erfahrung einer künstlichen Beatmung, die er während eines Komas in der Corona-Pandemie machte. Jonas Lüscher erwähnte an dieser Stelle seine Schwierigkeiten mit dem autofiktionalen Schreiben und die Herausforderung, rückblickend einen komatösen Daseinszustand zu beschreiben.
Jonas Lüscher und Frieder von Ammon in abschließender Diskussion © privat
Die Themen des Abends schienen beinahe unerschöpflich, doch musste er zu seinem Ende kommen. Mit einigen Worten aus Verzauberte Vorbestimmung entließ Jonas Lüscher das Publikum in das nächtliche München – voller Zuversicht für die zauberhafte Zukunft des Zentrums für Gegenwartsliteratur.