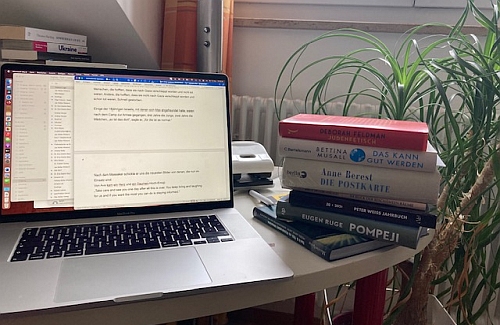Ein erzählerischer Israel-Essay
In Birgit Müller-Wielands erzählerischem Essay In einer anderen Wirklichkeit verharren die Ich-Erzählerin und ihre Freundin, deren Sohn Max im August 2022 nördlich von Tel Aviv auf einem internationalen Jugendaustausch weilt, in lähmender Angst um den Jungen. Die jüngsten Kriegsgeschehnisse und deren scheinbar ausweglose Komplexität holen die Erinnerung an diese Angst zurück und lösen in der Erzählerin ein intensives Ringen um einen angemessenen Zugang, ein Verstehen-Wollen des palästinensisch-israelischen „Konflikts“ aus.
Mit In einer anderen Wirklichkeit beteiligt sich Birgit Müller-Wieland an „Neustart Freie Szene – Literatur“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung der Freien Szene in Bayern. Alle bisherigen Beiträge des Projekts finden Sie HIER.
*
In einer anderen Wirklichkeit
„300 Raketen von Gaza abgeschossen“.
Ich stand in der Tür des kleinen Bades im Südtiroler Hotelzimmer, die Bewegung der Zahnbürste stockte im Mund. Aufgehellt war das Gesicht meiner Freundin, sie lag schon im Bett, im Dunkeln, mit dem Smartphone in der Hand.
*
Eine Woche zuvor, am letzten Schultag in München, hatte ich ihren Sohn Max nach der Zeugnisverteilung abgeholt und war mit ihm zum Flughafen gefahren. Seine Mutter hatte beruflich in Bozen zu tun, sodass ich diese Aufgabe übernahm.
Der Flug nach Tel Aviv ging zwar erst abends, aber wir waren von Bekannten instruiert worden; eine nützliche Information, denn der Terminal für Israel liegt weitab aller anderen, versteckt auf einem separaten Gelände hinter hohen Mauern und ja, man muss, um dahinzukommen, genug Zeit einplanen. Das war das Erste, was wir nach der Ankunft machten.
Auf unserem Erprobungsgang waren wir nach wenigen Metern allein. So weit die Blicke reichten, starrten wir in unbelebte Fluchten, niemand folgte uns, Türen öffneten sich, schlossen sich, niemand kam uns entgegen. Am Ende eines Laufbandes lachten wir: – „Ah, da ist wer, da hinten!“ –, aber das nächste Laufband setzte sich wieder nur für uns allein in Betrieb. Endlich angekommen, gähnte hinter den Mauern eine leere Welt. Schwarze Anzeigetafeln, verriegelte Eingänge, dunkles Glas, kein Lebewesen, nirgends. Ich fragte mich, ob das überall so war: Diese stillen Terminals – gab es sie in allen internationalen Flughäfen? Weit außerhalb des normalen Betriebs? Abgeschottet für einen einzigen Staat, für Israel allein? Oder war dies eine deutsche, speziell Münchner Maßnahme, nach den Ereignissen 1972? „Fitnessprogramm“, versuchte ich den etwas verzagten Max bei Laune zu halten, als wir den Rückweg antraten.
Nach dem Essen, Zeitunglesen und Zeittotschlagen erfuhren wir schließlich bei einem Schalter, dass man sich für Israel zusätzlich digital einloggen muss. Kein Problem, sagten wir uns. Nach etlichen Versuchen sank die Laune. Wir mussten Unterstützung finden. Irgendein falsch gesetztes Häkchen auf irgendeinem Button bewirkte immer wieder, dass der Vorgang abbrach, obwohl Max alles, so dachten wir, ordnungsgemäß beantwortet hatte. Das Groteske war, dass niemand helfen konnte. Weder die an den Informationsboxen Tätigen noch die Angestellten der weltbekannten Fluggesellschaft, mit der er reisen sollte: Alle schüttelten ratlos ihre Köpfe. Wir hielten ihnen das Smartphone vors Gesicht, aber sie lächelten nur verlegen, wandten sich ergebnislos an ihre Mitarbeitenden und vermochten auch keine Auskunft zu geben, um welche Uhrzeit genau der Terminal für Israel geöffnet werden würde.
„Das“, sagte ich in das ausdruckslose Gesicht der letzten Person, die wir fragten, „kann doch nicht sein.“ Sie zuckte mit den Schultern, als ich befremdet nachsetzte: „Meine Güte, das ist doch heute nicht der allererste Flug nach Israel!“
Wie surreal. Als sei dieses Land nur ein Phantom oder eine Leerstelle, etwas, worüber niemand wirklich Bescheid weiß. Ich rief die israelische Botschaft in Berlin an. Beim Anhören der Endlosschleife realisierte ich, dass Freitag war. Außerdem früher Abend mittlerweile. Max wirkte inzwischen jünger als er tatsächlich war, er biss die Zähne auf die Unterlippe, ein Bein auf dem anderen wippte heftig hin und her.
*
„Bist du sicher, dass du ihn allein nach Israel schicken willst?“
Diese Frage war meiner Freundin in den Monaten vor dem August 2022 mehrmals gestellt worden. Sie bejahte, denn das „Kind“, bald 18 Jahre alt, würde im Rahmen einer weltweit agierenden Organisation reisen.
Es ist ein Friedensprojekt, das seit siebzig Jahren lebenslange Freundschaften und Verbindungen quer über die Kontinente ermöglicht, auch mit Ländern wie China, Russland, Honduras, Guatemala, Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon. Max war mit elf Jahren in Costa Rica gewesen und erfahrungsreich in vielerlei Hinsicht zurückgekehrt. Die nachfolgenden Programme konnten dann wegen der Pandemie entweder gar nicht oder unter eingeschränkten Bedingungen nur national organisiert werden. Schließlich war er in seiner Altersgruppe für ein dreiwöchiges Camp in Israel ausgewählt worden, das eigentlich schon ein Jahr früher hätte stattfinden sollen und dem er nun nach der schweren Corona-Zeit, ja: entgegenfieberte.
An jenem Freitag am Münchner Flughafen half uns auch der Anruf beim israelischen Studenten einer Bekannten nicht. Eineinhalb Stunden vor Abflug befand dieser sich noch in seinem Wohnheim im Zentrum und zeigte nicht den geringsten Anflug von Stress. Ich hatte zufällig bei einer Begegnung mit ihm erfahren, dass auch er diesen Flug gebucht hatte und mir vorsorglich seine Nummer geben lassen. Der tiefenentspannte Student riet uns, einfach irgendwelche Zahlen einzugeben, wenn die richtige Passnummer nicht funktionierte…
Diese fröhliche Anarchie gefiel uns zwar sehr, fruchtete digital aber mitnichten. Ich war nun kurz davor, die Nerven zu verlieren und erneut zu einem Schalter zu stürmen, irgendeinem, das erkannte Max an meinem Griff zu seinem Smartphone sowie meinem Gesichtsausdruck. Er entwand mir das Gerät. „Fassung“, sagte er mit einer mir bis dato nicht bekannten Betonung, „Fassung bewahren. Ganz ruhig. Ich fange noch einmal von vorne an. Von ganz vorne“, und ich stand auf, trabte in einen Waschraum, Gesicht und Hände abkühlen.
Als ich zurückkam, grinste er mir entgegen. Wie er es geschafft hatte – „Oh, wir müssen jetzt los, schnell!“, war nun nebensächlich, er wusste es auch nicht genau, plötzlich hatte sich das richtige digitale Türchen geöffnet – also, Müll entsorgen, Handgepäck schultern, euphorisch marschierten wir los.
Einige Menschen mit Koffern befanden sich vor dem Terminal, als wir ankamen, und auf der Anzeigetafel blinkten Flugnummer, Zeit und Stadt. Alles war, wie es sein soll. In einem Glaskasten saß ein junger Mann mit strengem Gesicht. Rasche Verabschiedung. Ich erhaschte einen Blick auf die Schlange innen – war da nicht auch die Rückseite des israelischen Studenten?
Nachts weckte mich der Anruf. Er fahre gerade an Palmen vorbei, sagte Max, eine israelische Mutter bringe ihn und ein portugiesisches Mädchen, das zeitgleich mit ihm angekommen war, in den Kibbuz in den Norden. Er erreiche seine Mutter nicht, habe ihr eine SMS geschrieben, ich solle sie grüßen. Ich wusste, dass dies das letzte Gespräch für drei Wochen sein würde. Denn alle Geräte werden zu Beginn eines Camps abgegeben, ausnahmslos. Nichts soll während der Zeit des Zusammenseins ablenken. Erst nach dem Camp, wenn er noch einige Tage in Jerusalem und Tel Aviv bleiben würde, könnte er wieder Kontakt aufnehmen.
*
Als uns die Nachricht von den Raketen aus Gaza erreichte, befanden wir uns – ich war meiner Freundin nachgereist – im Hotel in Bozen.
„Bis wohin?“ fragte ich, spülte rasch aus, legte die Zahnbürste weg.
„Tel Aviv“, sagte meine Freundin.
Wie weit nördlich lag der Kibbuz noch mal? Wie hieß er überhaupt? Die Unterlagen waren in der Schublade in München.
„Bisher alle abgefangen“, sagte es tonlos vom Bett her, „aber die Leute mussten in die Bunker.“
Verfügte ein Kibbuz eigentlich über einen Bunker?
Es war kurz vor Mitternacht. Wir versuchten zu schlafen. Die Kontaktperson in München schickte anderntags eine Beruhigungs-SMS. Solange wir nichts hören würden, sei alles in Ordnung. Das klang logisch. Da ich im Gegensatz zu meiner Freundin, welche bis abends unterrichtete, in keinen zerstreuenden Tagesablauf eingebunden war, half diese SMS allerdings nur kurze Zeit. Andere Stellen antworteten nicht. Natürlich, es waren überall Ferien. Ein Tag verging, der nächste. In der Hitze Bozens aß ich Eis und schlich von Schatten zu Schatten. Schließlich riefen wir in Israel an. Es gehe allen sehr gut, sagte die Vorsitzende in Tel Aviv, Max sei vergnügt, sie habe ihn einige Tage zuvor gesehen. Und ja, es gebe einen Schutzraum im Kibbuz. Und selbstverständlich könnten die Jugendlichen ihre Angehörigen kontaktieren, wenn sie dies wünschten.
Oh. Ah. Ach so.
Es war verwirrend. Denn, so dachten wir, Max hätte diese Gelegenheit auf jeden Fall wahrgenommen. Er wusste doch, dass wir uns sorgten. Warum kam nichts, nicht mal ein winziges Daumenhoch-Emoji?
*
Es gibt eine Szene in einem Wehrmachtsfilm, den ich vor etlichen Jahren sah, und die sich nun, nach dem 7. Oktober 2023, mit einer neuen verzahnt. Im Kern ist es eine Geste.
Ein Mann und eine Frau gehen einige Schritte auf einem Feld, das endlos scheint unter dem weiten Himmel. Zu sehen sind nur die Rückseiten: Der Mann in Stiefeln, Uniform und Helm. Gut gekleidet, offenbar eine Städterin, in Mantel, Hütchen und Halbschuhen die junge, zierliche Frau. Sie trägt ein kleines Kind. In der einen Hand hält der Soldat sein Gewehr. Mit der anderen berührt er den Ellenbogen der Frau, – sie wehrt ab, mit einer heftigen Bewegung des Arms. In dieser winzigsten Spanne Zeit überfällt einen das Wissen, worum es hier geht.
Im nächsten Moment erschießt der Soldat die Mutter mit ihrem Kind.
Diese Szene, die sich dem Begreifen entzieht, hat mich nie wieder verlassen. Denn in die Geste dieses Soldaten könnte einen Bruchteil einer Sekunde so etwas wie Fürsorge hineinzulesen sein – ein Trugbild natürlich, sogleich hinweggefegt. Schwarz-weiß ist diese Passage aus dem Film, geräuschlos, und das Feld, in dem diese Hinrichtung stattfand, lag, ich habe es nicht behalten, in der Ukraine. Oder in Weißrussland. Oder in Polen.
Es gibt eine neue Szene, die sich nun untrennbar mit dieser verbindet für mich, sie ist farbig, und sie ist laut. Im Gegensatz zur namenlosen Mutter mit ihrem Kind auf jenem Feld im zweiten Weltkrieg hat die Frau in diesem Video einen Namen. Sie heißt Shiri Bibas und wurde gemeinsam mit ihren kleinen Söhnen Ariel und Kfir von der Hamas entführt.
Im Video, das die völlig Verängstigte zeigt, welche ihre beiden Kinder schützend an sich drückt, sind viele laute Stimmen zu hören, Männerkörper nah um sie herum zu sehen, die Köpfe nicht sichtbar. Die Kamera ist allein auf die Frau gerichtet, sie dreht sich zur einen, zur anderen Seite, die roten Haare ihrer Söhne leuchten aus der Decke, welche sie um sie geschlungen trägt, hervor. Eine männliche Hand berührt ihre Schulter, als würde sie etwas Begütigendes vorhaben. Schnitt. Ein anderer Arm legt sich auf ihren Rücken, schiebt sie aus dem Bild heraus, und wäre da nicht dieses Chaos von Schreien und Bewegung, ihre panischen Blicke, fast schiene es, als würde sie irgendwohin, in Sicherheit, geleitet werden –
Jetzt, da ich dies schreibe, geht die Nachricht um die Welt, dass der Vater bisher in Gefangenschaft überlebt hat, seine Frau hingegen soll mit Ariel, dem Vierjährigen und Kfir, dem zehn Monate alten Baby, bei einem israelischen Bombenangriff ums Leben gekommen sein.
Sollte das stimmen, und keine perfide Finte im psychologischen Krieg der Hamas gegen Israel sein, sind Shiri Bibas und ihre Kinder weitere Opfer auf der Schreckensliste, der Tag und Nacht neue Namen hinzugefügt werden – in Gaza und in Israel. Es ist die scheinbar endlose Abfolge des Horrors.
Alle Welt kennt das Video, in dem eine junge Frau mit gefesselten Händen von einem Mann mit Gewehr, der ihren Kopf hinunterdrückt, in ein Auto gezwungen wird. Sie trägt eine Jogginghose, und an ihrer Rückseite sieht man das Blut, eine dunkle Fläche vom Po bis zu den Schenkeln. Unerträglich sind die zunehmend bekannt werdenden Berichte von den israelischen Mädchen und Frauen, die vergewaltigt wurden und teilweise grauenvoll verstümmelt, bevor man sie erschoss.
Unerträglich die winzigen Frühgeborenen in Gaza zu sehen, ohne Brutkästen, ohne Schläuche, dünn wie Wollfäden, die sie durch die Nase am Leben erhalten sollten. Die Vorstellung, dass sie das Wichtigste, was sie neben Nahrung brauchen, entbehren müssen, die wärmende Haut ihrer Mütter und Väter nämlich, Mütter und Väter, die fliehen mussten und ihr Neugeborenes zurücklassen – sie ist unerträglich.
Die niedergebrannten Kibbuzim, einzeln umherliegende Schuhe, Puppen, Geschirr zwischen Blutlachen auf der einen, die Bombenruinen, Schuttberge, herumirrenden Menschen in Trümmerlandschaften auf der anderen Seite – unerträgliche Bilder, für immer graviert in unser aller Gedächtnis.
Erst in den letzten Wochen wurde mir bewusst, wie wenig ich von Israel und den palästinensischen Gebieten weiß. Wie im Strudel des Alltags mit seinen Zumutungen, verschärft durch die Jahre der Pandemie, des Ukraine-Kriegs, und der anwachsenden Naturkatastrophen die Aufnahmefähigkeit für diesen „Konflikt“ erschöpft war.
Nur am Rande habe ich die Auseinandersetzungen um den Historiker Achille Mbembe und die postkoloniale Theorie registriert. Jetzt, nach etlichen Lektüren und Gesprächen ist mir klarer, woher die globale Parteinahme allein für die palästinensische Position kommt.
Israel wird der postkolonialen Theorie zufolge, die viele linksgerichtete, viele Intellektuelle und muslimische Gruppen vertreten, als weißer, westlicher und kolonialistischer Staat angesehen. Dieser Interpretation gemäß ist die palästinensische Bevölkerung nur als Opfer anzusehen und wird seit 75 Jahren vertrieben, enteignet, unterdrückt. Wie alles, was Menschen betrifft, ist die Wahrheit weitaus komplexer, denke ich. Ja, es gab die Vertreibungen, die Zerstörung arabischer Dörfer, die Nakba mit den vielen entsetzlichen Ereignissen, die jedes für sich mitschuldig ist an der heutigen Situation.
Zugleich ist aber auch wahr:
Zu den Hundertausenden arabischen Flüchtlingen nach der Staatsgründung Israels sind etwa gleich viele jüdische Vertriebene zu rechnen, welche in den Jahren nach 1948 aus ihren bis dahin geltenden Heimatländern – dem Irak, Syrien, dem Libanon, Ägypten, Libyen, Marokko und anderen – aufgrund von Pogromen entweder nach Israel oder in westliche Staaten gelangten.
Niemand spricht von ihnen – warum nicht?
Vielleicht weil sie in demokratisch strukturierte Länder kamen, welche trotz vielerlei Schwierigkeiten, auch schwerwiegender Ungerechtigkeiten – wie beispielsweise im Falle der afrikanischen Juden und Jüdinnen in Israel –, schließlich eine Bleibe boten, einen Ort, an dem sich ein Leben aufbauen ließ.
Die Tragik der palästinensischen Menschen besteht hingegen unter anderem darin, dass sie in den arabischen Aufnahmestaaten niemals Bürgerrechte erhielten, die ihnen politische Teilhabe, Immobilienbesitz, Reisefreiheit etc. garantierten – außer in Jordanien, in dem 2,3 Millionen Nachfahren der Flüchtlinge leben. Nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 aber, als neue Flüchtlinge aus Gaza hinzukamen, wurden diese auch hier mit weniger Rechten ausgestattet und erhielten nur einen prekären Status.
Wenn über Jahrzehnte hinweg also in den Ländern um Israel herum palästinensische Menschen in der dritten Generation dem Traum von der Rückkehr in die einstmals verlorene Heimat Palästina anhängen, so hat dies auch mit ihrer Staatenlosigkeit, dem Leben in Flüchtlingsvierteln, der Armut und Perspektivlosigkeit zu tun.
Dass über diese lange Zeitstrecke keine Integration in den arabischen Aufnahmeländern erfolgt ist, bewirkte bei vielen den verständlichen Wunsch, ein besseres Leben in Europa zu suchen – was bei den meisten wiederum in temporäre Duldung oder erneute Staatenlosigkeit mündete.
Und diese bedeutet: Du darfst nicht arbeiten. Du darfst nicht wählen. Du darfst nicht reisen.
Wer bist du? Du bist unsichtbar. Du bist nichts.
Wundern wir uns wirklich über die Armuts- und in manchen Fällen Kriminalitätsschleife, aus der manche sich nicht befreien (können oder wollen), weil sie sich nie in den westlichen Gesellschaften verankern konnten, da diese aus vielerlei Gründen ihre Integration verhinderten?
Die Kinder und Enkel der vor Jahrzehnten nach Europa Gekommenen verbinden sich nun mit den erst kurz hierher Geflüchteten mit oder ohne Pass, jenen, welche um ihre Familien, um ihre Glaubensbrüder und -schwestern bangen, sie verbinden sich mit denen, für die Israel ein weißer Unterdrücker-Staat ist, mit denen, für die „die Juden“ schon immer an allem schuld waren – und denjenigen, die den Dschihad propagieren, wurde die Teilnahme an diesen Kundgebungen endlich verboten.
Die vielen anderen gehen in den deutschen und europäischen Städten mit den Slogans „Free Palestine“ auf die Straße, weil sie sich dem Ort nicht zugehörig fühlen, an dem sie aufgewachsen oder gelandet sind, weil sie in ghettoähnlichen Verhältnissen leben, weil ein transgenerationales Trauma sie gefangen hält, eine Sehnsucht nach dem Land ihrer Vorfahren vererbt wurde, weil sie dem Kapitalismus die Schuld geben, der Globalisierung, der Demokratie nicht mehr vertrauen oder noch nie vertraut haben, weil sie verstrickt sind in patriarchale Strukturen, weil sie, wenn sie männlich sind, sich ihrer Würde beraubt sehen, von Anfang an, und wenn sie weiblich sind und nicht willens, sich den Regeln zu fügen, sondern ein selbst bestimmtes Leben führen wollen, ständig in Angst und Gefahr existieren, und weil die Mehrheitsgesellschaft, also wir, es immer vorgezogen haben, wegzusehen, zu verdrängen, seit Jahrzehnten.
Rechtfertigt dies aber das radikale Verweigern von Empathie für die Verbrechen der Hamas, das Schlachten und Schänden von Jüdinnen und Juden?
Denn es war doch nichts anderes als eine perverse Lust am Schlachten und Schänden, welche die Männer der Hamas selbst dokumentierten? (Nie im Leben hätte ich vermutet, dass Begriffe, die aus altertümlichen, alttestamentarischen, barbarischen Zeiten stammen, gegenwärtiges Morden am ehesten bezeichnen werden.)
Wie können westliche Intellektuelle an Universitäten und Schulen weltweit allein die Seite der palästinensischen Not sehen, wenn diese doch untrennbar mit dem zuvor stattgefundenen Massaker verbunden ist? Wie können verstümmelte, enthauptete, verbrannte Babys, gefesselte Mädchen und Frauen, deren Becken gebrochen wurden durch die Vergewaltigungen dermaßen ausgelöscht werden aus menschlichem Fühlen?
*
Je mehr ich lese, desto mehr Ausweglosigkeit ballt sich zusammen. Immer war die Geschichte des Nahen Ostens, wenn in wenigen Momenten am Horizont ein Licht aufblinkte, eine Chronologie der verpassten Möglichkeiten.
Unter den vielen Stimmen, die seit dem 7. Oktober kluge, traurige und erhellende Wahrheiten formulieren, ist der Artikel Drei Formen von Antisemitismus von Aleida Assmann hilfreich, in dem sie den „einheimischen rechtsextremen Antisemitismus“ vom „muslimischen Antisemitismus“ und dem „linken Antisemitismus“ mit ihren je völlig anderen Voraussetzungen beschreibt und für größtmögliche Genauigkeit in der Unterscheidung plädiert: „Eine klarere Differenzierung der Antisemitismusbegriffe ist wichtig, weil sie der verbreiteten Instrumentalisierung des Begriffs für politische Zwecke entgegenwirken kann.“
© Birgit Müller-Wieland
Natan Sznaiders im SPIEGEL vom 25.11.23 erschienener Essay Nur die Verzweiflung kann uns retten ist ein Dokument der tiefsten Erschütterung, grundiert von der „Kluft zwischen den Juden in Israel und den Deutschen“, die „heute nicht mehr überwindbar (scheint).“
Während wir in Europa seit 1945, schreibt Sznaider, durch die Versöhnung ehemals feindlicher Länder, durch gemeinsame politische und ökonomische Interessen stabile Lebenswelten aufbauen konnten, existier(t)en Israelis im Gegensatz dazu „in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum, in einer anderen Wirklichkeit“.
Für Juden und Jüdinnen gibt und gab es nie eine Nachkriegszeit, so Sznaider: „Die Zeit nach der Shoa ist nie ‚danach‘, sie ist immer im Jetzt.“
Nur so lässt sich die Verteidigungsbereitschaft verstehen, die Israel über alle politischen Differenzen hinweg immerzu einte, eine kollektive Übereinkunft, wie sie auch im gegenwärtigen Kampf gegen die Hamas zu sehen ist. Seiner Meinung nach greift das universalistische Denken, das unsere westlichen Gesellschaften kennzeichnet, zu kurz: „Viele selbstlose Universalisten betrachten Israel als eine weiße, europäische Formation, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum erobert habe.“
Dem setzt er den israelischen Partikularismus entgegen, der Israel als ein „Projekt der Befreiung der Juden, die in und außerhalb Europas unterdrückt, verfolgt und auch ermordet wurden“, ansieht, eine Perspektive, aus der sich ein anderes Verständnis für die gegenwärtige Situation ergibt:
„Es heißt anzuerkennen, dass der 7. Oktober kein Teil des manchmal auch kriegerischen Hin und Her zwischen Israelis und Palästinensern der vergangenen Jahrzehnte ist. Sondern ein außerhalb des Konflikts stehendes Ereignis. Die Wiederkehr dessen, wogegen der Staat Israel einmal gegründet worden ist.“
Da das Undenkbare – ein Massaker im eigenen Land zu erleiden, wie es nach 1945 nicht mehr für möglich gehalten wurde – eingetreten ist, bleibt für Sznaider „nur eine verzweifelte Aussage, die wahr ist. Die Hamas-Terroristen sind grausame Dschihadisten, die mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. […] Das ist kein genozidaler Triumphalismus, sondern ein Akt der Verzweiflung, denn der 7. Oktober ist geschehen, was heißt, dass er immer wieder geschehen kann.“
Der Journalist Ari Shavit, über den Johanna Adorján in der Süddeutschen Zeitung vom 7.12.23 berichtet, sieht im Massaker zwei Monate zuvor keinen Angriff auf das Judentum. Nicht der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis sei die Triebkraft dieses Terrorangriffs gewesen, sondern der Kampf gegen „Israel als Demokratie.“
Shavit argumentiert mit den Opfern: Nicht Soldaten und Soldatinnen oder rechtsextreme Siedlerfamilien wurden ermordet oder verschleppt, nein, feiernde junge Menschen und seit Jahren um Ausgleich bemühte „Peacenics“ in den Kibbuzim seien es gewesen. „Hier kämpft der Dschihad gegen die westlichen Gesellschaften. Gegen die freie Welt. Gegen uns. Uns. […] Ist euch das nicht bewusst? Ihr seid die nächsten.“
*
Vor Max' erstem Anruf erreichten uns seine Bilder von tanzenden, schreibenden, lachenden, kochenden, aufmerksam einander zuhörenden jungen Menschen. Bilder vom Toten Meer, von Gassen und Gebäuden in Jerusalem, von Jad Vashem, der Klagemauer, von Märkten bei den Drusen an der Grenze zum Libanon. Als meine Freundin nun endlich seine Stimme hörte, fiel ihr das Gerät aus der Hand.
Zuerst verstand Max ihre Reaktion nicht. Später sagte er zerknirscht, dass er unsere Sorgen unterschätzt habe.
Ja, es hatte die Ansage gegeben, dass man die Eltern anrufen oder ihnen schreiben könne, und einige hätten dies auch getan. Da die meisten aber davon absahen – auch, weil die Israelis mit der Situation wie mit etwas Alltäglichem umgingen – wollte er nicht bei den wenigen dabei sein.
Es wurde ihnen der Schutzraum gezeigt und die Verhaltensweisen erklärt. Aber dass etwas Gefährliches passiere, sei nicht durchgedrungen, er habe es nicht so ernst genommen, es war alles ruhig bei ihnen, friedlich, cool. Die Dimension der Angriffe sei, so vermuteten wir, den Jugendlichen verschwiegen worden, um den Ablauf des Camps nicht zu riskieren.
Dies war verständlich. Unser Kopf begriff dieses Verhalten.
Es waren nur wenige Tage gewesen, in denen meine Freundin nichts von Max wusste. Es gab keinen einzigen Hinweis auf eine Gefährdung. Und doch…
Die Wellen von Angst, nicht zu wissen, was mit dem eigenen Kind ist, überschwemmten sie erneut nach dem 7. Oktober 2023.
Sie kamen, als wir das Ausmaß des Geschehens erfasst hatten und die Berichte von Menschen hörten und sahen, die nach ihren Lieben suchten. Menschen, die hofften, dass sie nach Gaza verschleppt worden und nicht tot waren. Andere, die hofften, dass sie nicht nach Gaza verschleppt worden und schon tot waren. Schnell gestorben.
Einige der 18-jährigen Israelis, mit denen sich Max über ein Jahr zuvor angefreundet hatte, waren nach dem Camp zur Armee gegangen – drei Jahre die Jungs, zwei Jahre die Mädchen, „so ist das dort“, sagte er, „für die ist es normal.“
Nach dem Hamas-Angriff schickte er uns die neuesten Bilder von denen, die nun im Einsatz sind. Von Ava in grüner Uniform, Sommersprossen auf der Nase, die hellen Haare unter dem Helm zusammengebunden, kamen ein Herz und ein Daumen-Hoch-Emoji: „Take care and see you one day after all this is over. You keep living and laughing for us and if you want the most you can do is staying informed.”
Ein erzählerischer Israel-Essay
In Birgit Müller-Wielands erzählerischem Essay In einer anderen Wirklichkeit verharren die Ich-Erzählerin und ihre Freundin, deren Sohn Max im August 2022 nördlich von Tel Aviv auf einem internationalen Jugendaustausch weilt, in lähmender Angst um den Jungen. Die jüngsten Kriegsgeschehnisse und deren scheinbar ausweglose Komplexität holen die Erinnerung an diese Angst zurück und lösen in der Erzählerin ein intensives Ringen um einen angemessenen Zugang, ein Verstehen-Wollen des palästinensisch-israelischen „Konflikts“ aus.
Mit In einer anderen Wirklichkeit beteiligt sich Birgit Müller-Wieland an „Neustart Freie Szene – Literatur“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung der Freien Szene in Bayern. Alle bisherigen Beiträge des Projekts finden Sie HIER.
*
In einer anderen Wirklichkeit
„300 Raketen von Gaza abgeschossen“.
Ich stand in der Tür des kleinen Bades im Südtiroler Hotelzimmer, die Bewegung der Zahnbürste stockte im Mund. Aufgehellt war das Gesicht meiner Freundin, sie lag schon im Bett, im Dunkeln, mit dem Smartphone in der Hand.
*
Eine Woche zuvor, am letzten Schultag in München, hatte ich ihren Sohn Max nach der Zeugnisverteilung abgeholt und war mit ihm zum Flughafen gefahren. Seine Mutter hatte beruflich in Bozen zu tun, sodass ich diese Aufgabe übernahm.
Der Flug nach Tel Aviv ging zwar erst abends, aber wir waren von Bekannten instruiert worden; eine nützliche Information, denn der Terminal für Israel liegt weitab aller anderen, versteckt auf einem separaten Gelände hinter hohen Mauern und ja, man muss, um dahinzukommen, genug Zeit einplanen. Das war das Erste, was wir nach der Ankunft machten.
Auf unserem Erprobungsgang waren wir nach wenigen Metern allein. So weit die Blicke reichten, starrten wir in unbelebte Fluchten, niemand folgte uns, Türen öffneten sich, schlossen sich, niemand kam uns entgegen. Am Ende eines Laufbandes lachten wir: – „Ah, da ist wer, da hinten!“ –, aber das nächste Laufband setzte sich wieder nur für uns allein in Betrieb. Endlich angekommen, gähnte hinter den Mauern eine leere Welt. Schwarze Anzeigetafeln, verriegelte Eingänge, dunkles Glas, kein Lebewesen, nirgends. Ich fragte mich, ob das überall so war: Diese stillen Terminals – gab es sie in allen internationalen Flughäfen? Weit außerhalb des normalen Betriebs? Abgeschottet für einen einzigen Staat, für Israel allein? Oder war dies eine deutsche, speziell Münchner Maßnahme, nach den Ereignissen 1972? „Fitnessprogramm“, versuchte ich den etwas verzagten Max bei Laune zu halten, als wir den Rückweg antraten.
Nach dem Essen, Zeitunglesen und Zeittotschlagen erfuhren wir schließlich bei einem Schalter, dass man sich für Israel zusätzlich digital einloggen muss. Kein Problem, sagten wir uns. Nach etlichen Versuchen sank die Laune. Wir mussten Unterstützung finden. Irgendein falsch gesetztes Häkchen auf irgendeinem Button bewirkte immer wieder, dass der Vorgang abbrach, obwohl Max alles, so dachten wir, ordnungsgemäß beantwortet hatte. Das Groteske war, dass niemand helfen konnte. Weder die an den Informationsboxen Tätigen noch die Angestellten der weltbekannten Fluggesellschaft, mit der er reisen sollte: Alle schüttelten ratlos ihre Köpfe. Wir hielten ihnen das Smartphone vors Gesicht, aber sie lächelten nur verlegen, wandten sich ergebnislos an ihre Mitarbeitenden und vermochten auch keine Auskunft zu geben, um welche Uhrzeit genau der Terminal für Israel geöffnet werden würde.
„Das“, sagte ich in das ausdruckslose Gesicht der letzten Person, die wir fragten, „kann doch nicht sein.“ Sie zuckte mit den Schultern, als ich befremdet nachsetzte: „Meine Güte, das ist doch heute nicht der allererste Flug nach Israel!“
Wie surreal. Als sei dieses Land nur ein Phantom oder eine Leerstelle, etwas, worüber niemand wirklich Bescheid weiß. Ich rief die israelische Botschaft in Berlin an. Beim Anhören der Endlosschleife realisierte ich, dass Freitag war. Außerdem früher Abend mittlerweile. Max wirkte inzwischen jünger als er tatsächlich war, er biss die Zähne auf die Unterlippe, ein Bein auf dem anderen wippte heftig hin und her.
*
„Bist du sicher, dass du ihn allein nach Israel schicken willst?“
Diese Frage war meiner Freundin in den Monaten vor dem August 2022 mehrmals gestellt worden. Sie bejahte, denn das „Kind“, bald 18 Jahre alt, würde im Rahmen einer weltweit agierenden Organisation reisen.
Es ist ein Friedensprojekt, das seit siebzig Jahren lebenslange Freundschaften und Verbindungen quer über die Kontinente ermöglicht, auch mit Ländern wie China, Russland, Honduras, Guatemala, Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon. Max war mit elf Jahren in Costa Rica gewesen und erfahrungsreich in vielerlei Hinsicht zurückgekehrt. Die nachfolgenden Programme konnten dann wegen der Pandemie entweder gar nicht oder unter eingeschränkten Bedingungen nur national organisiert werden. Schließlich war er in seiner Altersgruppe für ein dreiwöchiges Camp in Israel ausgewählt worden, das eigentlich schon ein Jahr früher hätte stattfinden sollen und dem er nun nach der schweren Corona-Zeit, ja: entgegenfieberte.
An jenem Freitag am Münchner Flughafen half uns auch der Anruf beim israelischen Studenten einer Bekannten nicht. Eineinhalb Stunden vor Abflug befand dieser sich noch in seinem Wohnheim im Zentrum und zeigte nicht den geringsten Anflug von Stress. Ich hatte zufällig bei einer Begegnung mit ihm erfahren, dass auch er diesen Flug gebucht hatte und mir vorsorglich seine Nummer geben lassen. Der tiefenentspannte Student riet uns, einfach irgendwelche Zahlen einzugeben, wenn die richtige Passnummer nicht funktionierte…
Diese fröhliche Anarchie gefiel uns zwar sehr, fruchtete digital aber mitnichten. Ich war nun kurz davor, die Nerven zu verlieren und erneut zu einem Schalter zu stürmen, irgendeinem, das erkannte Max an meinem Griff zu seinem Smartphone sowie meinem Gesichtsausdruck. Er entwand mir das Gerät. „Fassung“, sagte er mit einer mir bis dato nicht bekannten Betonung, „Fassung bewahren. Ganz ruhig. Ich fange noch einmal von vorne an. Von ganz vorne“, und ich stand auf, trabte in einen Waschraum, Gesicht und Hände abkühlen.
Als ich zurückkam, grinste er mir entgegen. Wie er es geschafft hatte – „Oh, wir müssen jetzt los, schnell!“, war nun nebensächlich, er wusste es auch nicht genau, plötzlich hatte sich das richtige digitale Türchen geöffnet – also, Müll entsorgen, Handgepäck schultern, euphorisch marschierten wir los.
Einige Menschen mit Koffern befanden sich vor dem Terminal, als wir ankamen, und auf der Anzeigetafel blinkten Flugnummer, Zeit und Stadt. Alles war, wie es sein soll. In einem Glaskasten saß ein junger Mann mit strengem Gesicht. Rasche Verabschiedung. Ich erhaschte einen Blick auf die Schlange innen – war da nicht auch die Rückseite des israelischen Studenten?
Nachts weckte mich der Anruf. Er fahre gerade an Palmen vorbei, sagte Max, eine israelische Mutter bringe ihn und ein portugiesisches Mädchen, das zeitgleich mit ihm angekommen war, in den Kibbuz in den Norden. Er erreiche seine Mutter nicht, habe ihr eine SMS geschrieben, ich solle sie grüßen. Ich wusste, dass dies das letzte Gespräch für drei Wochen sein würde. Denn alle Geräte werden zu Beginn eines Camps abgegeben, ausnahmslos. Nichts soll während der Zeit des Zusammenseins ablenken. Erst nach dem Camp, wenn er noch einige Tage in Jerusalem und Tel Aviv bleiben würde, könnte er wieder Kontakt aufnehmen.
*
Als uns die Nachricht von den Raketen aus Gaza erreichte, befanden wir uns – ich war meiner Freundin nachgereist – im Hotel in Bozen.
„Bis wohin?“ fragte ich, spülte rasch aus, legte die Zahnbürste weg.
„Tel Aviv“, sagte meine Freundin.
Wie weit nördlich lag der Kibbuz noch mal? Wie hieß er überhaupt? Die Unterlagen waren in der Schublade in München.
„Bisher alle abgefangen“, sagte es tonlos vom Bett her, „aber die Leute mussten in die Bunker.“
Verfügte ein Kibbuz eigentlich über einen Bunker?
Es war kurz vor Mitternacht. Wir versuchten zu schlafen. Die Kontaktperson in München schickte anderntags eine Beruhigungs-SMS. Solange wir nichts hören würden, sei alles in Ordnung. Das klang logisch. Da ich im Gegensatz zu meiner Freundin, welche bis abends unterrichtete, in keinen zerstreuenden Tagesablauf eingebunden war, half diese SMS allerdings nur kurze Zeit. Andere Stellen antworteten nicht. Natürlich, es waren überall Ferien. Ein Tag verging, der nächste. In der Hitze Bozens aß ich Eis und schlich von Schatten zu Schatten. Schließlich riefen wir in Israel an. Es gehe allen sehr gut, sagte die Vorsitzende in Tel Aviv, Max sei vergnügt, sie habe ihn einige Tage zuvor gesehen. Und ja, es gebe einen Schutzraum im Kibbuz. Und selbstverständlich könnten die Jugendlichen ihre Angehörigen kontaktieren, wenn sie dies wünschten.
Oh. Ah. Ach so.
Es war verwirrend. Denn, so dachten wir, Max hätte diese Gelegenheit auf jeden Fall wahrgenommen. Er wusste doch, dass wir uns sorgten. Warum kam nichts, nicht mal ein winziges Daumenhoch-Emoji?
*
Es gibt eine Szene in einem Wehrmachtsfilm, den ich vor etlichen Jahren sah, und die sich nun, nach dem 7. Oktober 2023, mit einer neuen verzahnt. Im Kern ist es eine Geste.
Ein Mann und eine Frau gehen einige Schritte auf einem Feld, das endlos scheint unter dem weiten Himmel. Zu sehen sind nur die Rückseiten: Der Mann in Stiefeln, Uniform und Helm. Gut gekleidet, offenbar eine Städterin, in Mantel, Hütchen und Halbschuhen die junge, zierliche Frau. Sie trägt ein kleines Kind. In der einen Hand hält der Soldat sein Gewehr. Mit der anderen berührt er den Ellenbogen der Frau, – sie wehrt ab, mit einer heftigen Bewegung des Arms. In dieser winzigsten Spanne Zeit überfällt einen das Wissen, worum es hier geht.
Im nächsten Moment erschießt der Soldat die Mutter mit ihrem Kind.
Diese Szene, die sich dem Begreifen entzieht, hat mich nie wieder verlassen. Denn in die Geste dieses Soldaten könnte einen Bruchteil einer Sekunde so etwas wie Fürsorge hineinzulesen sein – ein Trugbild natürlich, sogleich hinweggefegt. Schwarz-weiß ist diese Passage aus dem Film, geräuschlos, und das Feld, in dem diese Hinrichtung stattfand, lag, ich habe es nicht behalten, in der Ukraine. Oder in Weißrussland. Oder in Polen.
Es gibt eine neue Szene, die sich nun untrennbar mit dieser verbindet für mich, sie ist farbig, und sie ist laut. Im Gegensatz zur namenlosen Mutter mit ihrem Kind auf jenem Feld im zweiten Weltkrieg hat die Frau in diesem Video einen Namen. Sie heißt Shiri Bibas und wurde gemeinsam mit ihren kleinen Söhnen Ariel und Kfir von der Hamas entführt.
Im Video, das die völlig Verängstigte zeigt, welche ihre beiden Kinder schützend an sich drückt, sind viele laute Stimmen zu hören, Männerkörper nah um sie herum zu sehen, die Köpfe nicht sichtbar. Die Kamera ist allein auf die Frau gerichtet, sie dreht sich zur einen, zur anderen Seite, die roten Haare ihrer Söhne leuchten aus der Decke, welche sie um sie geschlungen trägt, hervor. Eine männliche Hand berührt ihre Schulter, als würde sie etwas Begütigendes vorhaben. Schnitt. Ein anderer Arm legt sich auf ihren Rücken, schiebt sie aus dem Bild heraus, und wäre da nicht dieses Chaos von Schreien und Bewegung, ihre panischen Blicke, fast schiene es, als würde sie irgendwohin, in Sicherheit, geleitet werden –
Jetzt, da ich dies schreibe, geht die Nachricht um die Welt, dass der Vater bisher in Gefangenschaft überlebt hat, seine Frau hingegen soll mit Ariel, dem Vierjährigen und Kfir, dem zehn Monate alten Baby, bei einem israelischen Bombenangriff ums Leben gekommen sein.
Sollte das stimmen, und keine perfide Finte im psychologischen Krieg der Hamas gegen Israel sein, sind Shiri Bibas und ihre Kinder weitere Opfer auf der Schreckensliste, der Tag und Nacht neue Namen hinzugefügt werden – in Gaza und in Israel. Es ist die scheinbar endlose Abfolge des Horrors.
Alle Welt kennt das Video, in dem eine junge Frau mit gefesselten Händen von einem Mann mit Gewehr, der ihren Kopf hinunterdrückt, in ein Auto gezwungen wird. Sie trägt eine Jogginghose, und an ihrer Rückseite sieht man das Blut, eine dunkle Fläche vom Po bis zu den Schenkeln. Unerträglich sind die zunehmend bekannt werdenden Berichte von den israelischen Mädchen und Frauen, die vergewaltigt wurden und teilweise grauenvoll verstümmelt, bevor man sie erschoss.
Unerträglich die winzigen Frühgeborenen in Gaza zu sehen, ohne Brutkästen, ohne Schläuche, dünn wie Wollfäden, die sie durch die Nase am Leben erhalten sollten. Die Vorstellung, dass sie das Wichtigste, was sie neben Nahrung brauchen, entbehren müssen, die wärmende Haut ihrer Mütter und Väter nämlich, Mütter und Väter, die fliehen mussten und ihr Neugeborenes zurücklassen – sie ist unerträglich.
Die niedergebrannten Kibbuzim, einzeln umherliegende Schuhe, Puppen, Geschirr zwischen Blutlachen auf der einen, die Bombenruinen, Schuttberge, herumirrenden Menschen in Trümmerlandschaften auf der anderen Seite – unerträgliche Bilder, für immer graviert in unser aller Gedächtnis.
Erst in den letzten Wochen wurde mir bewusst, wie wenig ich von Israel und den palästinensischen Gebieten weiß. Wie im Strudel des Alltags mit seinen Zumutungen, verschärft durch die Jahre der Pandemie, des Ukraine-Kriegs, und der anwachsenden Naturkatastrophen die Aufnahmefähigkeit für diesen „Konflikt“ erschöpft war.
Nur am Rande habe ich die Auseinandersetzungen um den Historiker Achille Mbembe und die postkoloniale Theorie registriert. Jetzt, nach etlichen Lektüren und Gesprächen ist mir klarer, woher die globale Parteinahme allein für die palästinensische Position kommt.
Israel wird der postkolonialen Theorie zufolge, die viele linksgerichtete, viele Intellektuelle und muslimische Gruppen vertreten, als weißer, westlicher und kolonialistischer Staat angesehen. Dieser Interpretation gemäß ist die palästinensische Bevölkerung nur als Opfer anzusehen und wird seit 75 Jahren vertrieben, enteignet, unterdrückt. Wie alles, was Menschen betrifft, ist die Wahrheit weitaus komplexer, denke ich. Ja, es gab die Vertreibungen, die Zerstörung arabischer Dörfer, die Nakba mit den vielen entsetzlichen Ereignissen, die jedes für sich mitschuldig ist an der heutigen Situation.
Zugleich ist aber auch wahr:
Zu den Hundertausenden arabischen Flüchtlingen nach der Staatsgründung Israels sind etwa gleich viele jüdische Vertriebene zu rechnen, welche in den Jahren nach 1948 aus ihren bis dahin geltenden Heimatländern – dem Irak, Syrien, dem Libanon, Ägypten, Libyen, Marokko und anderen – aufgrund von Pogromen entweder nach Israel oder in westliche Staaten gelangten.
Niemand spricht von ihnen – warum nicht?
Vielleicht weil sie in demokratisch strukturierte Länder kamen, welche trotz vielerlei Schwierigkeiten, auch schwerwiegender Ungerechtigkeiten – wie beispielsweise im Falle der afrikanischen Juden und Jüdinnen in Israel –, schließlich eine Bleibe boten, einen Ort, an dem sich ein Leben aufbauen ließ.
Die Tragik der palästinensischen Menschen besteht hingegen unter anderem darin, dass sie in den arabischen Aufnahmestaaten niemals Bürgerrechte erhielten, die ihnen politische Teilhabe, Immobilienbesitz, Reisefreiheit etc. garantierten – außer in Jordanien, in dem 2,3 Millionen Nachfahren der Flüchtlinge leben. Nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 aber, als neue Flüchtlinge aus Gaza hinzukamen, wurden diese auch hier mit weniger Rechten ausgestattet und erhielten nur einen prekären Status.
Wenn über Jahrzehnte hinweg also in den Ländern um Israel herum palästinensische Menschen in der dritten Generation dem Traum von der Rückkehr in die einstmals verlorene Heimat Palästina anhängen, so hat dies auch mit ihrer Staatenlosigkeit, dem Leben in Flüchtlingsvierteln, der Armut und Perspektivlosigkeit zu tun.
Dass über diese lange Zeitstrecke keine Integration in den arabischen Aufnahmeländern erfolgt ist, bewirkte bei vielen den verständlichen Wunsch, ein besseres Leben in Europa zu suchen – was bei den meisten wiederum in temporäre Duldung oder erneute Staatenlosigkeit mündete.
Und diese bedeutet: Du darfst nicht arbeiten. Du darfst nicht wählen. Du darfst nicht reisen.
Wer bist du? Du bist unsichtbar. Du bist nichts.
Wundern wir uns wirklich über die Armuts- und in manchen Fällen Kriminalitätsschleife, aus der manche sich nicht befreien (können oder wollen), weil sie sich nie in den westlichen Gesellschaften verankern konnten, da diese aus vielerlei Gründen ihre Integration verhinderten?
Die Kinder und Enkel der vor Jahrzehnten nach Europa Gekommenen verbinden sich nun mit den erst kurz hierher Geflüchteten mit oder ohne Pass, jenen, welche um ihre Familien, um ihre Glaubensbrüder und -schwestern bangen, sie verbinden sich mit denen, für die Israel ein weißer Unterdrücker-Staat ist, mit denen, für die „die Juden“ schon immer an allem schuld waren – und denjenigen, die den Dschihad propagieren, wurde die Teilnahme an diesen Kundgebungen endlich verboten.
Die vielen anderen gehen in den deutschen und europäischen Städten mit den Slogans „Free Palestine“ auf die Straße, weil sie sich dem Ort nicht zugehörig fühlen, an dem sie aufgewachsen oder gelandet sind, weil sie in ghettoähnlichen Verhältnissen leben, weil ein transgenerationales Trauma sie gefangen hält, eine Sehnsucht nach dem Land ihrer Vorfahren vererbt wurde, weil sie dem Kapitalismus die Schuld geben, der Globalisierung, der Demokratie nicht mehr vertrauen oder noch nie vertraut haben, weil sie verstrickt sind in patriarchale Strukturen, weil sie, wenn sie männlich sind, sich ihrer Würde beraubt sehen, von Anfang an, und wenn sie weiblich sind und nicht willens, sich den Regeln zu fügen, sondern ein selbst bestimmtes Leben führen wollen, ständig in Angst und Gefahr existieren, und weil die Mehrheitsgesellschaft, also wir, es immer vorgezogen haben, wegzusehen, zu verdrängen, seit Jahrzehnten.
Rechtfertigt dies aber das radikale Verweigern von Empathie für die Verbrechen der Hamas, das Schlachten und Schänden von Jüdinnen und Juden?
Denn es war doch nichts anderes als eine perverse Lust am Schlachten und Schänden, welche die Männer der Hamas selbst dokumentierten? (Nie im Leben hätte ich vermutet, dass Begriffe, die aus altertümlichen, alttestamentarischen, barbarischen Zeiten stammen, gegenwärtiges Morden am ehesten bezeichnen werden.)
Wie können westliche Intellektuelle an Universitäten und Schulen weltweit allein die Seite der palästinensischen Not sehen, wenn diese doch untrennbar mit dem zuvor stattgefundenen Massaker verbunden ist? Wie können verstümmelte, enthauptete, verbrannte Babys, gefesselte Mädchen und Frauen, deren Becken gebrochen wurden durch die Vergewaltigungen dermaßen ausgelöscht werden aus menschlichem Fühlen?
*
Je mehr ich lese, desto mehr Ausweglosigkeit ballt sich zusammen. Immer war die Geschichte des Nahen Ostens, wenn in wenigen Momenten am Horizont ein Licht aufblinkte, eine Chronologie der verpassten Möglichkeiten.
Unter den vielen Stimmen, die seit dem 7. Oktober kluge, traurige und erhellende Wahrheiten formulieren, ist der Artikel Drei Formen von Antisemitismus von Aleida Assmann hilfreich, in dem sie den „einheimischen rechtsextremen Antisemitismus“ vom „muslimischen Antisemitismus“ und dem „linken Antisemitismus“ mit ihren je völlig anderen Voraussetzungen beschreibt und für größtmögliche Genauigkeit in der Unterscheidung plädiert: „Eine klarere Differenzierung der Antisemitismusbegriffe ist wichtig, weil sie der verbreiteten Instrumentalisierung des Begriffs für politische Zwecke entgegenwirken kann.“
© Birgit Müller-Wieland
Natan Sznaiders im SPIEGEL vom 25.11.23 erschienener Essay Nur die Verzweiflung kann uns retten ist ein Dokument der tiefsten Erschütterung, grundiert von der „Kluft zwischen den Juden in Israel und den Deutschen“, die „heute nicht mehr überwindbar (scheint).“
Während wir in Europa seit 1945, schreibt Sznaider, durch die Versöhnung ehemals feindlicher Länder, durch gemeinsame politische und ökonomische Interessen stabile Lebenswelten aufbauen konnten, existier(t)en Israelis im Gegensatz dazu „in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum, in einer anderen Wirklichkeit“.
Für Juden und Jüdinnen gibt und gab es nie eine Nachkriegszeit, so Sznaider: „Die Zeit nach der Shoa ist nie ‚danach‘, sie ist immer im Jetzt.“
Nur so lässt sich die Verteidigungsbereitschaft verstehen, die Israel über alle politischen Differenzen hinweg immerzu einte, eine kollektive Übereinkunft, wie sie auch im gegenwärtigen Kampf gegen die Hamas zu sehen ist. Seiner Meinung nach greift das universalistische Denken, das unsere westlichen Gesellschaften kennzeichnet, zu kurz: „Viele selbstlose Universalisten betrachten Israel als eine weiße, europäische Formation, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum erobert habe.“
Dem setzt er den israelischen Partikularismus entgegen, der Israel als ein „Projekt der Befreiung der Juden, die in und außerhalb Europas unterdrückt, verfolgt und auch ermordet wurden“, ansieht, eine Perspektive, aus der sich ein anderes Verständnis für die gegenwärtige Situation ergibt:
„Es heißt anzuerkennen, dass der 7. Oktober kein Teil des manchmal auch kriegerischen Hin und Her zwischen Israelis und Palästinensern der vergangenen Jahrzehnte ist. Sondern ein außerhalb des Konflikts stehendes Ereignis. Die Wiederkehr dessen, wogegen der Staat Israel einmal gegründet worden ist.“
Da das Undenkbare – ein Massaker im eigenen Land zu erleiden, wie es nach 1945 nicht mehr für möglich gehalten wurde – eingetreten ist, bleibt für Sznaider „nur eine verzweifelte Aussage, die wahr ist. Die Hamas-Terroristen sind grausame Dschihadisten, die mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. […] Das ist kein genozidaler Triumphalismus, sondern ein Akt der Verzweiflung, denn der 7. Oktober ist geschehen, was heißt, dass er immer wieder geschehen kann.“
Der Journalist Ari Shavit, über den Johanna Adorján in der Süddeutschen Zeitung vom 7.12.23 berichtet, sieht im Massaker zwei Monate zuvor keinen Angriff auf das Judentum. Nicht der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis sei die Triebkraft dieses Terrorangriffs gewesen, sondern der Kampf gegen „Israel als Demokratie.“
Shavit argumentiert mit den Opfern: Nicht Soldaten und Soldatinnen oder rechtsextreme Siedlerfamilien wurden ermordet oder verschleppt, nein, feiernde junge Menschen und seit Jahren um Ausgleich bemühte „Peacenics“ in den Kibbuzim seien es gewesen. „Hier kämpft der Dschihad gegen die westlichen Gesellschaften. Gegen die freie Welt. Gegen uns. Uns. […] Ist euch das nicht bewusst? Ihr seid die nächsten.“
*
Vor Max' erstem Anruf erreichten uns seine Bilder von tanzenden, schreibenden, lachenden, kochenden, aufmerksam einander zuhörenden jungen Menschen. Bilder vom Toten Meer, von Gassen und Gebäuden in Jerusalem, von Jad Vashem, der Klagemauer, von Märkten bei den Drusen an der Grenze zum Libanon. Als meine Freundin nun endlich seine Stimme hörte, fiel ihr das Gerät aus der Hand.
Zuerst verstand Max ihre Reaktion nicht. Später sagte er zerknirscht, dass er unsere Sorgen unterschätzt habe.
Ja, es hatte die Ansage gegeben, dass man die Eltern anrufen oder ihnen schreiben könne, und einige hätten dies auch getan. Da die meisten aber davon absahen – auch, weil die Israelis mit der Situation wie mit etwas Alltäglichem umgingen – wollte er nicht bei den wenigen dabei sein.
Es wurde ihnen der Schutzraum gezeigt und die Verhaltensweisen erklärt. Aber dass etwas Gefährliches passiere, sei nicht durchgedrungen, er habe es nicht so ernst genommen, es war alles ruhig bei ihnen, friedlich, cool. Die Dimension der Angriffe sei, so vermuteten wir, den Jugendlichen verschwiegen worden, um den Ablauf des Camps nicht zu riskieren.
Dies war verständlich. Unser Kopf begriff dieses Verhalten.
Es waren nur wenige Tage gewesen, in denen meine Freundin nichts von Max wusste. Es gab keinen einzigen Hinweis auf eine Gefährdung. Und doch…
Die Wellen von Angst, nicht zu wissen, was mit dem eigenen Kind ist, überschwemmten sie erneut nach dem 7. Oktober 2023.
Sie kamen, als wir das Ausmaß des Geschehens erfasst hatten und die Berichte von Menschen hörten und sahen, die nach ihren Lieben suchten. Menschen, die hofften, dass sie nach Gaza verschleppt worden und nicht tot waren. Andere, die hofften, dass sie nicht nach Gaza verschleppt worden und schon tot waren. Schnell gestorben.
Einige der 18-jährigen Israelis, mit denen sich Max über ein Jahr zuvor angefreundet hatte, waren nach dem Camp zur Armee gegangen – drei Jahre die Jungs, zwei Jahre die Mädchen, „so ist das dort“, sagte er, „für die ist es normal.“
Nach dem Hamas-Angriff schickte er uns die neuesten Bilder von denen, die nun im Einsatz sind. Von Ava in grüner Uniform, Sommersprossen auf der Nase, die hellen Haare unter dem Helm zusammengebunden, kamen ein Herz und ein Daumen-Hoch-Emoji: „Take care and see you one day after all this is over. You keep living and laughing for us and if you want the most you can do is staying informed.”