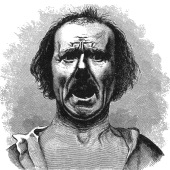Olga Flor im Gespräch über ihr neues Buch „Politik der Emotion“
Olga Flor wurde 1968 in Wien geboren und wuchs in Wien, Köln und Graz auf. Sie ist studierte Physikerin, arbeitete lange im Multimedia-Bereich und landete schließlich bei der Literatur. 2002 erschien ihr erster Roman Erlkönig. Seitdem folgten einige weitere, zuletzt Klartraum (2017). Außerdem verfasst sie als freie Autorin Kurzprosa, Essays sowie Theaterstücke und schreibt für verschiedene Tageszeitungen und Zeitschriften.
In ihrer neuen Essaysammlung Politik der Emotion (Residenz Verlag 2018), die aus der Grazer Vorlesungsreihe Unruhe bewahren hervorgegangen ist, nimmt sie den Leser in 14 kurzen Kapiteln mit auf eine breit gefächerte Reise rund um politische Stimmungsmache und die aktuellen Probleme der Weltpolitik. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erklärt sie ihre Sicht der Dinge und bringt es dabei mit klarer Sprache und vielen geistreichen Neologismen („islamistische Do-it-yourself-Terroristen“, „kollektiver Menschheitskater“) immer wieder auf den Punkt.
Dass sie sich mit dem Buch viel vorgenommen hat, erkennt die Autorin auch selbst: „Angesichts der Überfülle an Abstrusitäten hatte das Gefühl der Überforderung beim Schreiben dieses Essays solche Ausmaße erreicht, dass die Autorin sich wünschte, sie könnte die Auseinandersetzung mit der Gegenwart einfach absagen.“
Letztendlich entschied sie sich aber dafür, ebendieser „Biedermeierei“ den Kampf anzusagen, und bringt mit ihrem Buch ein wenig Licht ins Dunkel des weltpolitischen Chaos'. Im Interview mit dem Literaturportal Bayern spricht sie über die aktuelle politische Lage in Deutschland, ihre Beziehung zu Fakten und die gesellschaftliche Aufgabe von Literatur.
*
LITERATURPORTAL BAYERN: Trumps Twitterwahn, die Kurz-Politik in Österreich, Flüchtlingskrise, Dieselskandal, Globalisierung, Brexit ... – Sie sprechen in Ihrem Buch unglaublich viele verschiedene Themen an. Ist eine klare Trennung der zahlreichen politischen Baustellen heute gar nicht mehr möglich? Hängt alles irgendwie zusammen?
OLGA FLOR: Ja. Populistische Tendenzen wie etwa die Stimmungsmache gegen Medien, das Hetzen gegen Minderheiten, Angriffe auf den demokratischen Rechtsstaat sind ein internationales Phänomen, ebenso wie die nationalistische Internationale, die aber nicht nur begrifflich einen Widerspruch in sich darstellt, wie sich das etwa bei den jüngsten Querelen zwischen verschiedenen EU-Staaten in Sachen Flüchtlingsaufnahme ganz handfest zeigte.
Als deutsche Leserin bin ich ein wenig stutzig geworden, dass Sie bei den vielen internationalen Bezügen rund um Populismus und politische Stimmungsmache die Probleme Deutschlands mit der Pegida und der AfD nicht thematisieren. Hat das einen bestimmten Grund?
Nun, die Übernahme der AfD-Themen durch den politischen Mainstream – das Abwandern der Mitte nach rechts – war zum Zeitpunkt der Arbeit an dem Buch noch nicht in dem Ausmaß ausgeprägt, wie es heute in Deutschland durch die CSU versucht wird: und das im Übrigen, wie die Umfragen zu zeigen scheinen, ohne nennenswerten Erfolg in der Wählergunst. Dieses Schmied/Schmiedl-Phänomen wird im Buch an anderen Beispielen erläutert – insbesondere dem Österreichs, wo solche Strategien schon seit den 1990ern immer wieder versucht wurden.
Gibt es in einer Welt, in der Gefühle und das subjektive Wahrheitsempfinden immer mehr in den Vordergrund rücken, überhaupt noch so etwas wie Fakten?
Selbstverständlich. In der Naturwissenschaft etwa gibt es wiederholt beobachtbare Phänomene, die als Fakten bezeichnet werden: Regen fällt, die Erde dreht sich um die Sonne, die Auswirkungen der Gravitation sind eindeutig nachweisbar. Berichte darüber sind für mich glaubwürdig, wenn die Quellen sich klar zu journalistischem oder wissenschaftlichem Ethos bekennen.
Welche Quellen beziehen Sie persönlich, um sich über das politische Weltgeschehen zu informieren?
Zeitungen, on- und offline, Fernseh- und Radiodokumentationen: Guten alten Qualitätsjournalismus. Sach- und Fachbücher. Literatur. Augenschein, sofern der möglich ist. Gespräche.
Sie malen in Ihrem Buch an vielen Stellen ein eher düsteres Bild der Gegenwart und auch auf hoffnungsvolle Worte in Bezug auf zukünftige politische Entwicklungen wartet man als Leser vergebens. Würden Sie sich selbst als Pessimistin oder Realistin bezeichnen?
Man hält sich selbst vermutlich immer für realistisch.
Die letzte Kapitelüberschrift in Ihrem Buch lautet „Was nun?“ Wie sollte jeder Einzelne mit den aktuellen politischen Spannungen und Problemen umgehen? Wie können Lösungen aussehen?
Das versuche ich, wie gesagt, in Politik der Emotion kurz anzureißen, nicht dass ich glaube, dass es Patentlösungen gäbe. Ich denke, es ist entscheidend, sich auf den Wert demokratischer Strukturen zu besinnen, nicht umsonst haben Menschen jahrhundertelang darum gerungen, demokratische Staatswesen zu entwickeln und Verfassungen auszuarbeiten, die auf einem ausgeklügelten System von Interessensausgleich und Gewaltenteilung basieren, Menschenrechte garantieren und Minderheitenrechte respektieren. Ein solches System ist mühsam aufzubauen, eingerissen ist es mitunter schnell. Offene und faktenorientierte Kommunikation ist jedenfalls für jedes Gemeinwesen zentral. Basis jeder befriedigenden Kommunikation ist das genaue Hinsehen, das Zuhören und vor allem das Nachdenken.
Welche Aufgabe hat die Literatur in all dem?
Kunst verleitet günstigstenfalls zum Selberdenken, und wenn das selbstständige Denken gelingt, dann ist doch schon einiges gewonnen.
Olga Flor im Gespräch über ihr neues Buch „Politik der Emotion“
Olga Flor wurde 1968 in Wien geboren und wuchs in Wien, Köln und Graz auf. Sie ist studierte Physikerin, arbeitete lange im Multimedia-Bereich und landete schließlich bei der Literatur. 2002 erschien ihr erster Roman Erlkönig. Seitdem folgten einige weitere, zuletzt Klartraum (2017). Außerdem verfasst sie als freie Autorin Kurzprosa, Essays sowie Theaterstücke und schreibt für verschiedene Tageszeitungen und Zeitschriften.
In ihrer neuen Essaysammlung Politik der Emotion (Residenz Verlag 2018), die aus der Grazer Vorlesungsreihe Unruhe bewahren hervorgegangen ist, nimmt sie den Leser in 14 kurzen Kapiteln mit auf eine breit gefächerte Reise rund um politische Stimmungsmache und die aktuellen Probleme der Weltpolitik. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erklärt sie ihre Sicht der Dinge und bringt es dabei mit klarer Sprache und vielen geistreichen Neologismen („islamistische Do-it-yourself-Terroristen“, „kollektiver Menschheitskater“) immer wieder auf den Punkt.
Dass sie sich mit dem Buch viel vorgenommen hat, erkennt die Autorin auch selbst: „Angesichts der Überfülle an Abstrusitäten hatte das Gefühl der Überforderung beim Schreiben dieses Essays solche Ausmaße erreicht, dass die Autorin sich wünschte, sie könnte die Auseinandersetzung mit der Gegenwart einfach absagen.“
Letztendlich entschied sie sich aber dafür, ebendieser „Biedermeierei“ den Kampf anzusagen, und bringt mit ihrem Buch ein wenig Licht ins Dunkel des weltpolitischen Chaos'. Im Interview mit dem Literaturportal Bayern spricht sie über die aktuelle politische Lage in Deutschland, ihre Beziehung zu Fakten und die gesellschaftliche Aufgabe von Literatur.
*
LITERATURPORTAL BAYERN: Trumps Twitterwahn, die Kurz-Politik in Österreich, Flüchtlingskrise, Dieselskandal, Globalisierung, Brexit ... – Sie sprechen in Ihrem Buch unglaublich viele verschiedene Themen an. Ist eine klare Trennung der zahlreichen politischen Baustellen heute gar nicht mehr möglich? Hängt alles irgendwie zusammen?
OLGA FLOR: Ja. Populistische Tendenzen wie etwa die Stimmungsmache gegen Medien, das Hetzen gegen Minderheiten, Angriffe auf den demokratischen Rechtsstaat sind ein internationales Phänomen, ebenso wie die nationalistische Internationale, die aber nicht nur begrifflich einen Widerspruch in sich darstellt, wie sich das etwa bei den jüngsten Querelen zwischen verschiedenen EU-Staaten in Sachen Flüchtlingsaufnahme ganz handfest zeigte.
Als deutsche Leserin bin ich ein wenig stutzig geworden, dass Sie bei den vielen internationalen Bezügen rund um Populismus und politische Stimmungsmache die Probleme Deutschlands mit der Pegida und der AfD nicht thematisieren. Hat das einen bestimmten Grund?
Nun, die Übernahme der AfD-Themen durch den politischen Mainstream – das Abwandern der Mitte nach rechts – war zum Zeitpunkt der Arbeit an dem Buch noch nicht in dem Ausmaß ausgeprägt, wie es heute in Deutschland durch die CSU versucht wird: und das im Übrigen, wie die Umfragen zu zeigen scheinen, ohne nennenswerten Erfolg in der Wählergunst. Dieses Schmied/Schmiedl-Phänomen wird im Buch an anderen Beispielen erläutert – insbesondere dem Österreichs, wo solche Strategien schon seit den 1990ern immer wieder versucht wurden.
Gibt es in einer Welt, in der Gefühle und das subjektive Wahrheitsempfinden immer mehr in den Vordergrund rücken, überhaupt noch so etwas wie Fakten?
Selbstverständlich. In der Naturwissenschaft etwa gibt es wiederholt beobachtbare Phänomene, die als Fakten bezeichnet werden: Regen fällt, die Erde dreht sich um die Sonne, die Auswirkungen der Gravitation sind eindeutig nachweisbar. Berichte darüber sind für mich glaubwürdig, wenn die Quellen sich klar zu journalistischem oder wissenschaftlichem Ethos bekennen.
Welche Quellen beziehen Sie persönlich, um sich über das politische Weltgeschehen zu informieren?
Zeitungen, on- und offline, Fernseh- und Radiodokumentationen: Guten alten Qualitätsjournalismus. Sach- und Fachbücher. Literatur. Augenschein, sofern der möglich ist. Gespräche.
Sie malen in Ihrem Buch an vielen Stellen ein eher düsteres Bild der Gegenwart und auch auf hoffnungsvolle Worte in Bezug auf zukünftige politische Entwicklungen wartet man als Leser vergebens. Würden Sie sich selbst als Pessimistin oder Realistin bezeichnen?
Man hält sich selbst vermutlich immer für realistisch.
Die letzte Kapitelüberschrift in Ihrem Buch lautet „Was nun?“ Wie sollte jeder Einzelne mit den aktuellen politischen Spannungen und Problemen umgehen? Wie können Lösungen aussehen?
Das versuche ich, wie gesagt, in Politik der Emotion kurz anzureißen, nicht dass ich glaube, dass es Patentlösungen gäbe. Ich denke, es ist entscheidend, sich auf den Wert demokratischer Strukturen zu besinnen, nicht umsonst haben Menschen jahrhundertelang darum gerungen, demokratische Staatswesen zu entwickeln und Verfassungen auszuarbeiten, die auf einem ausgeklügelten System von Interessensausgleich und Gewaltenteilung basieren, Menschenrechte garantieren und Minderheitenrechte respektieren. Ein solches System ist mühsam aufzubauen, eingerissen ist es mitunter schnell. Offene und faktenorientierte Kommunikation ist jedenfalls für jedes Gemeinwesen zentral. Basis jeder befriedigenden Kommunikation ist das genaue Hinsehen, das Zuhören und vor allem das Nachdenken.
Welche Aufgabe hat die Literatur in all dem?
Kunst verleitet günstigstenfalls zum Selberdenken, und wenn das selbstständige Denken gelingt, dann ist doch schon einiges gewonnen.