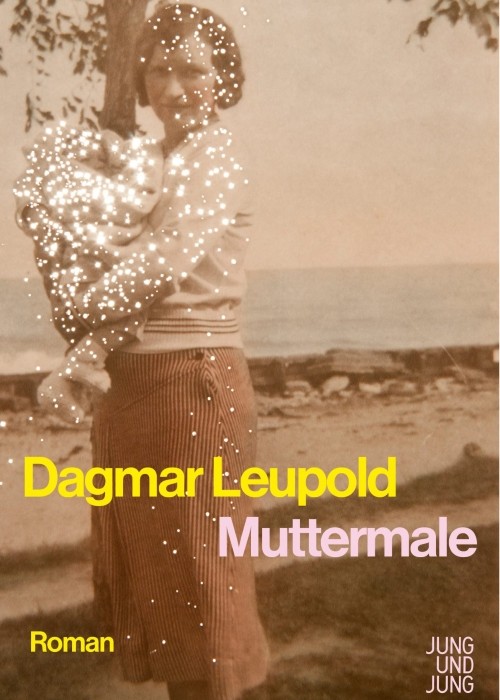Rezension zu Dagmar Leupolds Roman „Muttermale“
In ihrem jüngsten Roman Muttermale erzählt Dagmar Leupold, die heute ihren 70. Geburtstag feiert, von einer Mutter-Tochter-Beziehung, in der die Gewalterfahrung aus Krieg und Flucht noch Jahrzehnte später nachhallt. Das Buch ist für den Bayerischen Buchpreis 2025 nominiert. Gelesen für das Literaturportal Bayern hat es die Autorin Carola Gruber.
*
Es ist die Geschichte zweier Menschen, die einander verpassen: „Wenn wir beide, du und ich, Magnete waren, dann solche, die sich stets mit der abstoßenden Seite einander näherten und die entscheidende Drehung, die zur Anziehung geführt hätte, nicht schafften.“ So blickt das „Ich“ in Dagmar Leupolds neuem Roman Muttermale auf die Beziehung zur verstorbenen Mutter zurück. Es ist die Bilanz einer Beziehung, die nie unbefangen war, nie herzlich, sondern immer belastet.
Die Mutter stammt aus Ostpreußen, ist 1945 als junge Frau von dort geflohen und wurde anschließend in Dänemark interniert: Als Rotkreuzschwester pflegte sie bis zum November 1947 verletzte deutsche Soldaten. Später verschlug es sie an den Rhein, wo sie eine Familie gründete. Doch trotz Mann, Kind, Haus schlägt sie dort keine Wurzeln: Der neue Wohnort wird zur „kleinen Heimat“, während „ganz zu Hause“ weiterhin Ostpreußen meint – einen verlorenen Ort, der zeitlebens Gegenstand wehmütiger, verklärender Erinnerung bleibt.
„Dein Leben nach dem Krieg zu würdigen, bedeutet Schadensvermessung“, schreibt die Tochter folgerichtig. Sie gehört zum Nachkriegsleben der Mutter, einem Leben, das gezeichnet ist von Verlusten, aber auch von Härte und Selbstbeherrschung.
„Dichthalten“ als oberstes Ziel
Offenkundig hat die Mutter Gewalt erlebt, spricht aber nicht darüber. Sie „hält dicht“ – und wird so für die Tochter zur „verschlossenen, schweigsamen Mutter“, deren Profil „unlesbar wie eine glatte Felsoberfläche“ ist. Angespanntheit – bis in die Kiefergelenke – und ein ständig spürbares Unglück prägen den Alltag. Auch Kleinigkeiten geraten zur Zerreißprobe, etwa, wenn das Kinderzimmer in den Augen der Mutter unordentlich ist.
Herzlichkeit und Unbeschwertheit sucht man in dieser Beziehung vergebens. Mutter und Tochter verfehlen einander auf ähnliche Weise, so ist bei der Lektüre zu ahnen, wie auch die Mutter ihr eigenes Leben in dem Maß verfehlt, wie es ihr nicht gelingt, im Hier und Jetzt anzukommen: bei der Tochter, in der „kleinen Heimat“.
Fast schon provokant wirken da kurze Momente der Gelöstheit: die Freigiebigkeit im Urlaub in Österreich, die Versöhnung zu Weihnachten, die lockere Stimmung beim Besuch in der Pizzeria, die Weitergabe von Rezepten – Augenblicke, in denen es zwischen Mutter und Tochter eine zarte Verbindung gibt. Doch die „Leitung“ zwischen beiden ist stets von Störungen bedroht.
Erzählen in Bruchstücken
Erzählt wird diese Mutter-Tochter-Geschichte in kurzen, fragmentartigen Kapiteln. Die Tochter lässt Gegenstände, Gewohnheiten, Redewendungen und Fotos Revue passieren wie Fundstücke oder Beweismittel. Das Erinnern läuft hier ab wie ein Gang in die „Asservatenkammer“.
Kleine Beobachtungen lassen die Beziehung zwischen Mutter und Tochter plastisch werden und fügen sich zu einer Art Mosaik. Der Titel Muttermale lässt sich als bildhafte Bezeichnung für diese Textform lesen – aber auch für die Art von Erfahrung, um die es hier geht: Male, die uns von Geburt an mitgegeben werden.
Dass hierbei keine fortlaufende Erzählung entsteht, sondern Bruchstücke oder Miniaturen nebeneinander gelegt werden, passt gut zur hier erzählten Beziehung, die ihrerseits von Lücken geprägt ist – ganz besonders von solchen in der Kommunikation.
So wird, wenn die Tochter Stationen aus dem Leben der Mutter rekapituliert, immer wieder deutlich, wie wenig die beiden Frauen einander kannten. Manche Erinnerungsstücke wirken rätselhaft: Handelt es sich beim jungen Mann auf jenem Foto möglicherweise um den Verlobten, der im Krieg getötet wurde? Oder ist es der Cousin der Mutter, jener, den die Schwester heiraten wollte?
Wie nebenbei schreitet der Roman die Chronologie des Lebens der Mutter ab: von der Flucht und der Internierung in Dänemark über die Familiengründung bis hin zum Altern samt Rollenumkehr mit der nun sorgenden Tochter.
Bis zum Tod gibt es keine Aussöhnung, nur das emotionale Verpassen – und die traurige Erkenntnis der Tochter, dass sie der Mutter Schmerz bereitet hat, unvermeidbar, durch ihre bloße Existenz.
Spuren der Gewalt
Diese Rückschau könnte bitter wirken. Doch vor allem wirkt sie bedrückend, ist weniger Vorwurf als eben literarische „Schadensvermessung“. Denn auch wenn ausschließlich aus Perspektive der Tochter erzählt wird, so sind doch Leid und Unglück der Mutter deutlich zu spüren.
Damit ist der behutsam erzählte biografische Roman auch ein Dokument der zerstörerischen Kraft von Gewalt und Schweigen. Er zeigt, wie diese in Familien ihre Spuren hinterlassen: „Verschüttete Erzählwege wurden weder freigelegt noch neue angelegt. Unser und vieler Familien Verhängnis und Gefängnis zugleich. So blieb jeder in seinem Schmerz verplombt.“
Hierin liegt eine besondere Stärke dieses Romans: Er geht über die individuelle Geschichte dieser einen Mutter und dieser einen Familie hinaus. Er zeigt Bezüge zur Generation und zur Zeitgeschichte auf, ist somit auch das Portrait einer Mentalität, die eine bestimmte Frauengeneration prägte.
Vor über zwanzig Jahren hat Leupold ein Buch über den Vater veröffentlicht, Nach den Kriegen. Auch darin geht es um das laute Schweigen über die Vergangenheit. Und doch: „Das Schweigen der Mütter war ein anderes als das der Väter“, sagte die Autorin kürzlich in einem ![]() Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So schildert das Buch über den Vater einen Akteur in der NS-Zeit, der anderen Schaden zugefügt und später darüber nicht gesprochen hat. Das Schweigen der Mutter hingegen ist das in Häuslichkeit verkapselte „Dichthalten“ einer Frau, die sich stets als Opfer begriffen hat und sich damit die Möglichkeit verstellte, die eigene Erfahrung zeitgeschichtlich einzuordnen.
Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So schildert das Buch über den Vater einen Akteur in der NS-Zeit, der anderen Schaden zugefügt und später darüber nicht gesprochen hat. Das Schweigen der Mutter hingegen ist das in Häuslichkeit verkapselte „Dichthalten“ einer Frau, die sich stets als Opfer begriffen hat und sich damit die Möglichkeit verstellte, die eigene Erfahrung zeitgeschichtlich einzuordnen.
Muttermale ist keine leichte oder heitere Lektüre. Stattdessen bereichert dieser Roman seine Lesenden durch einen klaren Blick auf diese Art von weiblichem Schweigen.
Dagmar Leupold: Muttermale. Jung und Jung Verlag 2025, 176 S., ISBN: 978-3-99027-419-4.
Rezension zu Dagmar Leupolds Roman „Muttermale“
In ihrem jüngsten Roman Muttermale erzählt Dagmar Leupold, die heute ihren 70. Geburtstag feiert, von einer Mutter-Tochter-Beziehung, in der die Gewalterfahrung aus Krieg und Flucht noch Jahrzehnte später nachhallt. Das Buch ist für den Bayerischen Buchpreis 2025 nominiert. Gelesen für das Literaturportal Bayern hat es die Autorin Carola Gruber.
*
Es ist die Geschichte zweier Menschen, die einander verpassen: „Wenn wir beide, du und ich, Magnete waren, dann solche, die sich stets mit der abstoßenden Seite einander näherten und die entscheidende Drehung, die zur Anziehung geführt hätte, nicht schafften.“ So blickt das „Ich“ in Dagmar Leupolds neuem Roman Muttermale auf die Beziehung zur verstorbenen Mutter zurück. Es ist die Bilanz einer Beziehung, die nie unbefangen war, nie herzlich, sondern immer belastet.
Die Mutter stammt aus Ostpreußen, ist 1945 als junge Frau von dort geflohen und wurde anschließend in Dänemark interniert: Als Rotkreuzschwester pflegte sie bis zum November 1947 verletzte deutsche Soldaten. Später verschlug es sie an den Rhein, wo sie eine Familie gründete. Doch trotz Mann, Kind, Haus schlägt sie dort keine Wurzeln: Der neue Wohnort wird zur „kleinen Heimat“, während „ganz zu Hause“ weiterhin Ostpreußen meint – einen verlorenen Ort, der zeitlebens Gegenstand wehmütiger, verklärender Erinnerung bleibt.
„Dein Leben nach dem Krieg zu würdigen, bedeutet Schadensvermessung“, schreibt die Tochter folgerichtig. Sie gehört zum Nachkriegsleben der Mutter, einem Leben, das gezeichnet ist von Verlusten, aber auch von Härte und Selbstbeherrschung.
„Dichthalten“ als oberstes Ziel
Offenkundig hat die Mutter Gewalt erlebt, spricht aber nicht darüber. Sie „hält dicht“ – und wird so für die Tochter zur „verschlossenen, schweigsamen Mutter“, deren Profil „unlesbar wie eine glatte Felsoberfläche“ ist. Angespanntheit – bis in die Kiefergelenke – und ein ständig spürbares Unglück prägen den Alltag. Auch Kleinigkeiten geraten zur Zerreißprobe, etwa, wenn das Kinderzimmer in den Augen der Mutter unordentlich ist.
Herzlichkeit und Unbeschwertheit sucht man in dieser Beziehung vergebens. Mutter und Tochter verfehlen einander auf ähnliche Weise, so ist bei der Lektüre zu ahnen, wie auch die Mutter ihr eigenes Leben in dem Maß verfehlt, wie es ihr nicht gelingt, im Hier und Jetzt anzukommen: bei der Tochter, in der „kleinen Heimat“.
Fast schon provokant wirken da kurze Momente der Gelöstheit: die Freigiebigkeit im Urlaub in Österreich, die Versöhnung zu Weihnachten, die lockere Stimmung beim Besuch in der Pizzeria, die Weitergabe von Rezepten – Augenblicke, in denen es zwischen Mutter und Tochter eine zarte Verbindung gibt. Doch die „Leitung“ zwischen beiden ist stets von Störungen bedroht.
Erzählen in Bruchstücken
Erzählt wird diese Mutter-Tochter-Geschichte in kurzen, fragmentartigen Kapiteln. Die Tochter lässt Gegenstände, Gewohnheiten, Redewendungen und Fotos Revue passieren wie Fundstücke oder Beweismittel. Das Erinnern läuft hier ab wie ein Gang in die „Asservatenkammer“.
Kleine Beobachtungen lassen die Beziehung zwischen Mutter und Tochter plastisch werden und fügen sich zu einer Art Mosaik. Der Titel Muttermale lässt sich als bildhafte Bezeichnung für diese Textform lesen – aber auch für die Art von Erfahrung, um die es hier geht: Male, die uns von Geburt an mitgegeben werden.
Dass hierbei keine fortlaufende Erzählung entsteht, sondern Bruchstücke oder Miniaturen nebeneinander gelegt werden, passt gut zur hier erzählten Beziehung, die ihrerseits von Lücken geprägt ist – ganz besonders von solchen in der Kommunikation.
So wird, wenn die Tochter Stationen aus dem Leben der Mutter rekapituliert, immer wieder deutlich, wie wenig die beiden Frauen einander kannten. Manche Erinnerungsstücke wirken rätselhaft: Handelt es sich beim jungen Mann auf jenem Foto möglicherweise um den Verlobten, der im Krieg getötet wurde? Oder ist es der Cousin der Mutter, jener, den die Schwester heiraten wollte?
Wie nebenbei schreitet der Roman die Chronologie des Lebens der Mutter ab: von der Flucht und der Internierung in Dänemark über die Familiengründung bis hin zum Altern samt Rollenumkehr mit der nun sorgenden Tochter.
Bis zum Tod gibt es keine Aussöhnung, nur das emotionale Verpassen – und die traurige Erkenntnis der Tochter, dass sie der Mutter Schmerz bereitet hat, unvermeidbar, durch ihre bloße Existenz.
Spuren der Gewalt
Diese Rückschau könnte bitter wirken. Doch vor allem wirkt sie bedrückend, ist weniger Vorwurf als eben literarische „Schadensvermessung“. Denn auch wenn ausschließlich aus Perspektive der Tochter erzählt wird, so sind doch Leid und Unglück der Mutter deutlich zu spüren.
Damit ist der behutsam erzählte biografische Roman auch ein Dokument der zerstörerischen Kraft von Gewalt und Schweigen. Er zeigt, wie diese in Familien ihre Spuren hinterlassen: „Verschüttete Erzählwege wurden weder freigelegt noch neue angelegt. Unser und vieler Familien Verhängnis und Gefängnis zugleich. So blieb jeder in seinem Schmerz verplombt.“
Hierin liegt eine besondere Stärke dieses Romans: Er geht über die individuelle Geschichte dieser einen Mutter und dieser einen Familie hinaus. Er zeigt Bezüge zur Generation und zur Zeitgeschichte auf, ist somit auch das Portrait einer Mentalität, die eine bestimmte Frauengeneration prägte.
Vor über zwanzig Jahren hat Leupold ein Buch über den Vater veröffentlicht, Nach den Kriegen. Auch darin geht es um das laute Schweigen über die Vergangenheit. Und doch: „Das Schweigen der Mütter war ein anderes als das der Väter“, sagte die Autorin kürzlich in einem ![]() Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So schildert das Buch über den Vater einen Akteur in der NS-Zeit, der anderen Schaden zugefügt und später darüber nicht gesprochen hat. Das Schweigen der Mutter hingegen ist das in Häuslichkeit verkapselte „Dichthalten“ einer Frau, die sich stets als Opfer begriffen hat und sich damit die Möglichkeit verstellte, die eigene Erfahrung zeitgeschichtlich einzuordnen.
Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So schildert das Buch über den Vater einen Akteur in der NS-Zeit, der anderen Schaden zugefügt und später darüber nicht gesprochen hat. Das Schweigen der Mutter hingegen ist das in Häuslichkeit verkapselte „Dichthalten“ einer Frau, die sich stets als Opfer begriffen hat und sich damit die Möglichkeit verstellte, die eigene Erfahrung zeitgeschichtlich einzuordnen.
Muttermale ist keine leichte oder heitere Lektüre. Stattdessen bereichert dieser Roman seine Lesenden durch einen klaren Blick auf diese Art von weiblichem Schweigen.
Dagmar Leupold: Muttermale. Jung und Jung Verlag 2025, 176 S., ISBN: 978-3-99027-419-4.