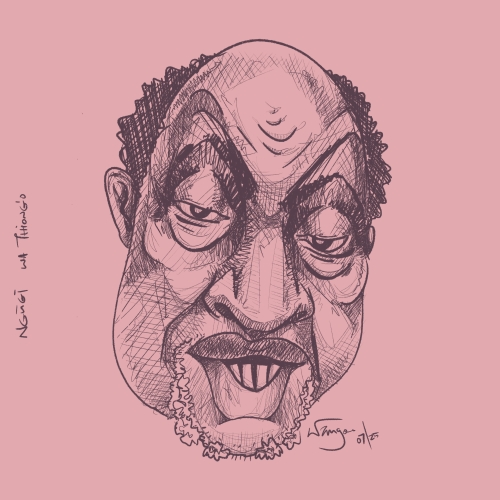Zur Entstehung des kollektiven Theaterprojekts „This Plot is not for Sale“ (II). Deutsche Fassung
Das Projekt mit dem Arbeitstitel Land of Tropes entstand als ein kollektives, fünfsprachiges Theaterprojekt über Erinnerung, Zugehörigkeit, Postkolonialismus und Schuld. Es wird derzeit unter der Leitung des NMT(Netzwerk Münchner Theatertexter*innen) in Nairobi und München sowie im digitalen Raum realisiert und am 31. Oktober 2025 bei ![]() SPIELART unter dem Titel This Plot is not for Sale uraufgeführt. Das Literaturportal Bayern begleitet diese spannende herausfordernde Projektarbeit sowohl in Hinblick auf die Aufführung im Herbst berichtend als auch im Vorfeld fördernd, indem es die drei maßgeblich beteiligten Autorinnen und Autoren gebeten hat, über ihre Arbeit und die dazugehörigen sprachlich-kulturellen Bewusstseinsprozesse in essayistischer Form zu reflektieren.
SPIELART unter dem Titel This Plot is not for Sale uraufgeführt. Das Literaturportal Bayern begleitet diese spannende herausfordernde Projektarbeit sowohl in Hinblick auf die Aufführung im Herbst berichtend als auch im Vorfeld fördernd, indem es die drei maßgeblich beteiligten Autorinnen und Autoren gebeten hat, über ihre Arbeit und die dazugehörigen sprachlich-kulturellen Bewusstseinsprozesse in essayistischer Form zu reflektieren.
Der zweite Beitrag „Englisch, meine Muttersprache“ stammt von der kenianischen Autorin ![]() Ursula Gisemba und wurde auf Englisch verfasst. Dies ist nun die deutsche Fassung. Sie wurde von
Ursula Gisemba und wurde auf Englisch verfasst. Dies ist nun die deutsche Fassung. Sie wurde von ![]() Lisa Risch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
Lisa Risch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
*
I. Was ist meine Muttersprache?
Ist Englisch meine Muttersprache? Meine Mutter sprach mit mir Kiswahili, manchmal Englisch. Aber die Muttersprache meiner Mutter ist weder Kiswahili noch Englisch – ihre Mutter sprach mit ihr Ekegusii, was, wie mir gesagt wurde, meine Muttersprache sein sollte. Aber meine Großmutter sprach mit mir Kiswahili.
Oxford Languages definiert „mother tongue (Muttersprache)“ als die erste Sprache, der eine Person von Geburt an ausgesetzt ist.
Merriam-Webster definiert „mother tongue (Muttersprache)“ als die Sprache der Heimat eines Menschen.
Bei dem Studium von Wörterbüchern stelle ich fest, dass sie keine neutralen Speicherorte für Bedeutungen sind. Die Definition eines Wortes hängt von Ideologie und kulturellen Annahmen seines Kontexts ab.
Nun, was war ich von Geburt an ausgesetzt? Das ist kompliziert. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin mir sicher, dass mein Vokabular ein neutraler Mix aus Englisch und Kiswahili war. Die Definition von Oxford Languages disqualifiziert Ekegusii. Ich kenne Ekegusii nur als die Sprache, in der Erwachsene lästern. The Sprache wurde lauter, wenn ich die Konversation nicht verstehen sollte. Die letztere Definition qualifiziert Ekegusii; in Kenia ist dies die vereinbarte Definition von Muttersprache.
Was schwirrt in meinem Gehirn herum? Englisch.
Ich habe ein großes Geheimnis… Meine Träume sind auf Englisch… Träume wie: die sich auflösenden Welten des Unterbewusstseins, die aussprechbaren und unaussprechlichen Monster, die unbekannten Gesichter des Schlafs. Dann auch Träume wie: Hoffnungen für die Zukunft, wie ich mich mir vorstelle, wie ich meine Umgebung in Zukunft sehe. Einfach viele Leute, die Englisch sprechen.
Als ich Ende 2023 Gespräche mit Autor*innen des Netzwerk Münchner Theatertexter*innen (NMT) begann, suchten wir nach Berührungspunkten zwischen Nairobi und München. Schnell stellten wir uns Fragen über die Sprache des Theaters. Meine Münchner Kolleg*innen waren über die fehlende Tradition des Schreibens in sogenannten Muttersprachen und Kiswahili überrascht. Viele Autor*innen, vor allem Theaterautor*innen, neigen zum Englischen. Das Land und die Heimat von Ngũgĩ wa Thiong’o, der Decolonising the Mind (1986)[1] schrieb, hätte sicherlich eine lange Reihe an Kenianer*innen hervorbringen müssen, die in ihrer Muttersprache schreiben. In seinen Essays hinterfragt er zu Recht die Afrikanische Literaturszene, die typischerweise in anglophone, frankophon und lusophone Literatur unterteilt wird und wo unsere Heimatsprachen wenig Beachtung finden. Er fordert einen radikalen Wandel: die Annahme unserer Muttersprachen, um der kulturellen Amnesie des neokolonialen Staates und seiner Weiterführung kolonialen Vermächtnisses entgegenzuwirken. Ich habe Ngũgĩ nie getroffen, aber ich habe viel mit ihm zu teilen.
Ngũgĩ, es hat sich nicht viel geändert.
Ngũgĩ spricht davon die ‚Afro-Europäische‘ Literatur im Jahr 1977 zurückzulassen, um in seiner Muttersprache Gikuyu zu schreiben.[2] Dieser Genese war geprägt von einem seiner bedeutendsten Theaterstücke Ngaahika Ndeda (Ich heirate, wann ich will), das er gemeinsam mit Ngũgĩ wa Miiri geschrieben hat. Das Stück war eine Antwort auf einen Aufruf von der Gemeinschaft in Kamiirithu, die sich vom auf Englisch geschriebenen Theater entfremdet gefühlt hat. Um das Stück zu entwickeln, arbeiteten die zwei Autor*innen mit der Gemeinschaft und nutzten dabei nicht nur die lokale Sprache, sondern erlaubten auch kontinuierlichen Input, der von Realität des Alltagsleben der Menschen beeinflusst wurde. Das Theaterstück wurde von lokalen Stimmen geprägt, wobei die Fähigkeit, das Leben zu verkörpern, die wichtigste Qualifikation war. Dieser Ansatz beeinflusste den Stil, die Charaktere, den Ton und sogar den sich entwickelnden Casting-Prozess. Dies resultierte in einem Theater, welches er als näher an der Dialektik des Lebens als an Poesie oder Fiktion lobt.[3]
Und dennoch ist auch Jahre später Englisch noch das Höchste. Wir mixen all unsere lokalen Tendenzen hinein, wir improvisieren, und trotzdem… Wozu sonst sollte sich ein Volk entschließen, das auf Englisch unterrichtet wird? Viele Kenianer*innen werden Ihnen von der ‚Disc‘ erzählen. Dies kann ein kleines, oder in anderen Schulen ein großes, Stück Holz sein, das man sich um den Hals hängt. Die Disc wird der Person gegeben, die in einer anderen Sprache außer Englisch sprach; die Person reicht sie der nächsten Person, die sie hört, und so weiter. Am Ende des Tages, wird die Kette zurückverfolgt und jede Person, die die Disc bekommen hatte, wird bestraft. Ngũgĩ schrieb darüber, dass dies in den 1950ern passierte. Ich habe es in den 2000ern und 2010ern erlebt.
Ngũgĩ. Zeichnung von Alfred Wango mit freundlicher Genehmigung. © Alfred Wango
Ngũgĩ, das ist immer noch gängige Praxis.
In Black Skin, White Masks (Schwarze Haut, Weiße Masken) verspottet Frantz Fanon uns: „Ein Mensch, der eine Sprache hat, besitzt folglich die Welt, die durch diese Sprache ausgedrückt und impliziert wird.“[4] Englisch das ganze Leben zu sprechen garantiert den kenianischen Student*innen, die einst durch die Kette der Disc betraft wurden, keinen uneingeschränkten Zugang zum Vereinigten Königreich. Trotz ihrer Bestnoten in Englisch aus der Schule müssen sie sich Sprachtests unterziehen, um eine Universität im Vereinigten Königreich zu besuchen.
Mein Vater lobte oft Königin Elizabeth II. Elizabeth, genau wie der Name meiner Mutter. Seine Loyalität dem Königshaus gegenüber ist ein Anzeichen für die auseinanderstrebenden Meinungen der unterschiedlichen Generationen. Er sagt, sie sei elegant, ich sage, sie sei eine Kolonisatorin. Er erinnert sich an Stipendien, ich denke an Gatekeeping. Elizabeth, als Königin oder Mutter, war jemand in unseren Köpfen.
Als ich mit den Autor*innen des NMT zusammensaß und über die Notlage von Muttersprachen nachdachte, sagte ich schließlich resigniert: „Englisch ist meine Muttersprache, die Queen ist meine Mutter.“
Sprache, Muttersprachen, war die erste Frage.
II. Eine formwandelnde Sprache gewinnt Verbündete
Es ist 2023. Ich bin zum ersten Mal in München für eine dreimonatige Künstler*innen-Residenz; zum ersten Mal in Europa; und zum ersten Mal in einer Stadt, in der die Hauptsprache der Anweisungen eine Sprache ist, die ich nicht kenne. München ist ebenfalls in Bayern, wo „Guten Morgen, Tag, Abend,“ oft mit „Servus“ ersetzt wird. Nur eine Person in der S-Bahn hat zu mir „Auf Wiedersehen“ gesagt. Stattdessen habe ich gelernt „Tschüss“ oder „Ciao“ zu sagen und mir zu merken, dass der deutsche Äquivalent tatsächlich „Tschau“ geschrieben wird!
Zum Ende meines dritten Monats in München, bekam ich Heimweh. Aber die Symptome waren kein Verlangend nach dem Land Kenia. In der S-Bahn sagt die Durchsage „Nächster Halt…“ und wiederholt dies wieder und wieder bei allen Haltestellen sodass ich gereizt werde. Das unerklärliche Verlangen war das Deutsch, dass mich verzehrte:
Der Kassierer spricht mit einem weißen Mann auf Englisch aber antwortet mir auf Deutsch, obwohl er klar bemerkt, dass ich ihn nicht verstehe.
In einer regnerischen Nacht fährt die S-Bahn nicht und es fällt mir schwer ein Taxi zu bekommen, bis auf das Letzte. Kein Taxifahrer hat die Geduld mir zu sagen, was ihr letzter Halt ist. Irgendwie war der Letzte der Freundlichste.
Der Mann im Vodafone-Shop weigert sich, mich zu bedienen.
Und ja! Jemand hatte mir bereits gesagt: „Das ist Deutschland, sprich Deutsch!“
Was ist diese Feindseligkeit in der Sprache? Ich wollte Kiswahili mit Englisch gemixt hören, ich wollte den kenianischen Akzent hören, ich sehnte mich nach der kenianischen Art zu sprechen. Das Heimweh war ein vielschichtiger Ausbruch von Schmerz aufgrund anhaltender Mikro-Agressionen. Ich musste einen Preis zahlen, denn es lohnt sich, sich an die Sprache der Orte anzupassen, an denen man gesehen werden will. Niemand fragt mich, ob ich meine Muttersprache gelernt habe. Tatsächlich verlangen sie von mir, eine andere europäische Sprache zu erlernen. Aus Trotz gegen diese sprachliche Gewalt habe ich nie Deutsch gelernt. Als ich endlich auf dem Flughafen zuhause landete, verspürte ich eine tiefe Erleichterung.
Ngũgĩ, was habe ich dieser Welt zu erzählen, die mich, um in ihr zu existieren, weiter von meiner Sprache wegschiebt?
2024 begannen wir endlich mit der Arbeit an unserer internationalen Kollaboration. Bei der Entwicklung meiner Figure Pete, lies ich die Wiedersprüche der Afrikaner*innen in Bewegung in sie einfließen.
Petes Herkunft basiert auf Afrikanischer Migration auf der Suche nach Chancen. Sie wandelt sich und ändert ihr Auftreten zu dem, was die Situation verlangt. Wir werden oft an diesen afrikanischen Fleiß erinnert bevor wir das Haus unserer Eltern verlassen: „Du musst dort hingehen und dreimal so hart arbeiten, um dieselben Möglichkeiten zu erhalten.“ Anders als ich, verschwendet Pete keine Zeit mit Trotz, sondern schwört stattdessen auf die Meritokratie. Daher spricht Pete Deutsch als sie die deutsche Figur Katharina trifft.
Pete weiß, dass Sprache ein Schlüssel zur Seele ist. Während des Theaterstücks, wandelt sie durch Englisch, Kiswahili, Ekegusii und Deutsch. Ihre Absicht ist es, mehr und mehr Chancen in der Welt zu finden, mit allen Mitteln Reichtum aufzubauen. Für Pete ist das Erlernen einer neuen Sprache eine kleine Unannehmlichkeit auf dem Weg zu einer größeren Belohnung. Ob es das Wechseln zwischen verschiedenen Sprachcodes oder das Perfektionieren des richtigen Akzents ist, Pete strebt danach, sich an die Welt anzupassen, in der sie sich bewegt.
Und indem ich sie schrieb, brachte Pete mir Deutsch bei.
Pete veranschaulicht eine bedauernswerte Wahrheit: Sprache geht oft der Wahrnehmung voraus.
Ngũgĩ, meine Stimme kämpft dafür, dass mein Gesicht gesehen wird.
Die sich wandelnde Stimme, die nicht nur verschiedene Sprachen spricht, sondern auch verschiedene Register anwenden und sich in den verschiedenen Sphären des Lebens entsprechend präsentieren kann, ist eine gut erlernte Rüstung. In gewisser Weise findet eine Akkulturation statt, die die Spaltung der schwarzafrikanischen Persönlichkeit fördert. Wie Pete Achile Mbembe zitiert: „Wie eine Art riesiger Käfig ist die schwarze Vernunft in Wahrheit ein kompliziertes Netzwerk aus Verdopplung, Unsicherheit und Zweideutigkeit, das mit der Rasse als Gerüst aufgebaut ist.“[5]
Die Akzeptanz der Komplikationen von Sprache und der Verlust der Mehrsprachigkeit zugunsten europäischer Sprachen waren eine starke Grundlage für den von uns entwickelten Text. Wir entschieden uns für eine Veränderung und erlaubten den Figuren miteinander zu sprechen wie sie es gewöhnt sind. Wir fordern das Publikum auf, sich auf die Struktur unbekannter Sprachen einzulassen.
Dies ist besonders in Kenia so, wo es nicht üblich ist, Übertitel zu haben. Ich freue mich darauf, zu erfahren wie das Publikum dies erlebt, da viele von ihnen noch nie Theater mit Übertiteln gesehen haben. Normerweise geht man nicht zu Stücken, bei denen man die Sprache nicht versteht. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Schreiben: wenn ich die Sprache nicht spreche, schreibe ich sie nicht.
Zum ersten Mal übersetzte ich einen Text nach Ekegusii. Zum ersten Mal spreche ich Ekegusii in der Öffentlichkeit.
Ngũgĩ, Pete hat mir meine verlorene Muttersprache beigebracht.
III. THIS PLOT IS NOT FOR SALE
Wenn man sich in Kenia bewegt, sieht man oft die Worte ‚THIS PLOT IS NOT FOR SALE‘ (‚DIESES GRUNDSTÜCK STEHT NICHT ZUM VERKAUF‘[6]) groß auf einer Wand gemalt oder auf einem kleinen Schildern neben einem Tor. Dies ist kein Zeichen von Sorgfalt seitens der Grundstückeigentümer*innen, sondern ein Hinweis auf einen vorausgegangene Betrugsversuche, bei denen Hochstapler versuchen Grundstücke zu verkaufen, die ihnen nicht gehören.
Unser Projekt begann unter dem Arbeitstitel ‚Land of Tropes‘ (‚Land der Tropen‘) mit einem Fokus darauf, Stereotypen und Klischees zu untersuchen, denen wir uns gegenseitig in Bildern aussetzen. Die Figuren Pete (aus Kenia) und Kathi (aus Deutschland) nehmen erwartete Haltungen zu Kolonisation ein. Währenddessen entwickelt die dritte Figur, Stevan (aus dem ehemaligen Jugoslawien) eine ungewöhnliche Zwischenform ein, die von der Bewegung der Blockfreien Staaten beeinflusst ist, in der Jugoslawien sich mit den ehemals kolonisierten Staaten solidarisierte. Stevan, der ein Fotograf ist, steht im Mittelpunkt des Entstehungsprozesses dieser Bildreproduktion.
Durch Stevans absurdes Fotostudio, entsteht Satire und die Widersprüche ihrer Welt treten an die Oberfläche. Pete und ihr deutsches Gegenüber Kathi bauen mit ihrer gut gemeinten, klischeeartigen NGO eine unlogische Welt auf. Wir sehen, wie Pete um Raum verhandelt und auf ihrer Mehrsprachigkeit aufbaut. Aber das geht über ihre Sprache und ihren Körper hinaus, ihr Schweigen ist immer vielschichtig.
Für Pete bedeutet die Verantwortungen schwarzer Afrikaner*innen eine Last an Stereotypen, die ihrer Persönlichkeit aufgedrückt werden und durch harte Arbeit losgeworden werden können. Pete erscheint mit diesen Klischees, die an ihr haften. Sie ist beeinflusst von der schwierigen Zwischenposition, in der die Mittelschicht die aufgedrückten Klischees zu ihrem Vorteil über jene nutzen kann, die ihr Wissen überschätzen.
In Anerkennung dieser Dilemmas, änderte sich der Titel zu ‚THIS PLOT IS NOT FOR SALE.‘ Ein Aha-Moment im Schreibprozess. Der Titel erfasst das Vorgehen der Figuren, die beispielhaft für die Position stehen, kontinuierlich ideologischen Platz im Raum zu verhandeln. Diese Spannung zwingt sie dazu, ihre Wahrheit zu verstecken.
Die Schwere des kontinuierlichen Rollenspiels ist ein Geist in Petes Leben. Vor Stevans Kamera realisiert sie, dass die Wahrheit der einzige Weg ist, um aus dem Klischee zu entkommen, das ihr von dieser Bildreproduktion aufgezwungen wurde. Pete muss in gewisser Weise aufhören die Form zu verändern, akzeptieren wo sie herkommt und sich den Problemen stellen, die sie selbst aufrechterhält. Ihre Wahrheit kommt ans Licht, wenn sie Ekegusii spricht. Pete ehrt die postkolonialen Sprachargumente von Ngũgĩ.
Ngũgĩ, habe ich einige Tränen deiner neokolonialen Klage getrocknet?[7]
Letztendlich entspricht das Theaterstück nicht komplett Ngũgĩs Perspektive aber ist ein Startpunkt. Es hinterfragt, wie Sprache als Mittel zur Legitimierung genutzt wird und den Preis, der dafür gezahlt werden muss. ‚THIS PLOT IS NOT FOR SALE‘ fordert seine Figuren dazu auf, die Fassade fallen zu lassen.
Die Zusammenarbeit hat neue Türen zu Fragen aufgeworfen und aufregende Möglichkeiten für meine Performance in Ekegusii, Deutsch, Englisch und Kiswahili eröffnet. Die Magie dieser Erforschung und die Verlagerung dieser Sprachen in neue Räume ist nur in dieser ungewöhnlichen Konstellation an Autor*innen möglich.
Wie Pete, bin auch ich letztendlich mit vielen Sprachen überhäuft und auf der Suche nach dem Sinn. In jedem Moment auf der Suche nach einer Stimme. Auswählend, verwerfend, hinterfragend.
[1] 2018 erschien erstmals die deutsche Übersetzung Dekolonisierung des Denkens.
[2] Ngũgĩ wa Thiong’o, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature (London: James Currey, 1986), 27.
[3] Ngũgĩ, Decolonising the Mind, 54.
[4] Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, trans. Charles Lam Markmann (London: Pluto Press, 1986), 18.
[5] Achille Mbembe, Critique of Black Reason, trans. Laurent Dubois (Durham, NC: Duke University Press, 2017), 10.
[6] ‚Plot‘ in diesem Kontext bezeichnet ein Stück Land, kann aber auch die Handlung einer Geschichte bedeuten.
[7] Decolonising the Mind, Preface, xii
Zur Entstehung des kollektiven Theaterprojekts „This Plot is not for Sale“ (II). Deutsche Fassung
Das Projekt mit dem Arbeitstitel Land of Tropes entstand als ein kollektives, fünfsprachiges Theaterprojekt über Erinnerung, Zugehörigkeit, Postkolonialismus und Schuld. Es wird derzeit unter der Leitung des NMT(Netzwerk Münchner Theatertexter*innen) in Nairobi und München sowie im digitalen Raum realisiert und am 31. Oktober 2025 bei ![]() SPIELART unter dem Titel This Plot is not for Sale uraufgeführt. Das Literaturportal Bayern begleitet diese spannende herausfordernde Projektarbeit sowohl in Hinblick auf die Aufführung im Herbst berichtend als auch im Vorfeld fördernd, indem es die drei maßgeblich beteiligten Autorinnen und Autoren gebeten hat, über ihre Arbeit und die dazugehörigen sprachlich-kulturellen Bewusstseinsprozesse in essayistischer Form zu reflektieren.
SPIELART unter dem Titel This Plot is not for Sale uraufgeführt. Das Literaturportal Bayern begleitet diese spannende herausfordernde Projektarbeit sowohl in Hinblick auf die Aufführung im Herbst berichtend als auch im Vorfeld fördernd, indem es die drei maßgeblich beteiligten Autorinnen und Autoren gebeten hat, über ihre Arbeit und die dazugehörigen sprachlich-kulturellen Bewusstseinsprozesse in essayistischer Form zu reflektieren.
Der zweite Beitrag „Englisch, meine Muttersprache“ stammt von der kenianischen Autorin ![]() Ursula Gisemba und wurde auf Englisch verfasst. Dies ist nun die deutsche Fassung. Sie wurde von
Ursula Gisemba und wurde auf Englisch verfasst. Dies ist nun die deutsche Fassung. Sie wurde von ![]() Lisa Risch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
Lisa Risch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
*
I. Was ist meine Muttersprache?
Ist Englisch meine Muttersprache? Meine Mutter sprach mit mir Kiswahili, manchmal Englisch. Aber die Muttersprache meiner Mutter ist weder Kiswahili noch Englisch – ihre Mutter sprach mit ihr Ekegusii, was, wie mir gesagt wurde, meine Muttersprache sein sollte. Aber meine Großmutter sprach mit mir Kiswahili.
Oxford Languages definiert „mother tongue (Muttersprache)“ als die erste Sprache, der eine Person von Geburt an ausgesetzt ist.
Merriam-Webster definiert „mother tongue (Muttersprache)“ als die Sprache der Heimat eines Menschen.
Bei dem Studium von Wörterbüchern stelle ich fest, dass sie keine neutralen Speicherorte für Bedeutungen sind. Die Definition eines Wortes hängt von Ideologie und kulturellen Annahmen seines Kontexts ab.
Nun, was war ich von Geburt an ausgesetzt? Das ist kompliziert. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin mir sicher, dass mein Vokabular ein neutraler Mix aus Englisch und Kiswahili war. Die Definition von Oxford Languages disqualifiziert Ekegusii. Ich kenne Ekegusii nur als die Sprache, in der Erwachsene lästern. The Sprache wurde lauter, wenn ich die Konversation nicht verstehen sollte. Die letztere Definition qualifiziert Ekegusii; in Kenia ist dies die vereinbarte Definition von Muttersprache.
Was schwirrt in meinem Gehirn herum? Englisch.
Ich habe ein großes Geheimnis… Meine Träume sind auf Englisch… Träume wie: die sich auflösenden Welten des Unterbewusstseins, die aussprechbaren und unaussprechlichen Monster, die unbekannten Gesichter des Schlafs. Dann auch Träume wie: Hoffnungen für die Zukunft, wie ich mich mir vorstelle, wie ich meine Umgebung in Zukunft sehe. Einfach viele Leute, die Englisch sprechen.
Als ich Ende 2023 Gespräche mit Autor*innen des Netzwerk Münchner Theatertexter*innen (NMT) begann, suchten wir nach Berührungspunkten zwischen Nairobi und München. Schnell stellten wir uns Fragen über die Sprache des Theaters. Meine Münchner Kolleg*innen waren über die fehlende Tradition des Schreibens in sogenannten Muttersprachen und Kiswahili überrascht. Viele Autor*innen, vor allem Theaterautor*innen, neigen zum Englischen. Das Land und die Heimat von Ngũgĩ wa Thiong’o, der Decolonising the Mind (1986)[1] schrieb, hätte sicherlich eine lange Reihe an Kenianer*innen hervorbringen müssen, die in ihrer Muttersprache schreiben. In seinen Essays hinterfragt er zu Recht die Afrikanische Literaturszene, die typischerweise in anglophone, frankophon und lusophone Literatur unterteilt wird und wo unsere Heimatsprachen wenig Beachtung finden. Er fordert einen radikalen Wandel: die Annahme unserer Muttersprachen, um der kulturellen Amnesie des neokolonialen Staates und seiner Weiterführung kolonialen Vermächtnisses entgegenzuwirken. Ich habe Ngũgĩ nie getroffen, aber ich habe viel mit ihm zu teilen.
Ngũgĩ, es hat sich nicht viel geändert.
Ngũgĩ spricht davon die ‚Afro-Europäische‘ Literatur im Jahr 1977 zurückzulassen, um in seiner Muttersprache Gikuyu zu schreiben.[2] Dieser Genese war geprägt von einem seiner bedeutendsten Theaterstücke Ngaahika Ndeda (Ich heirate, wann ich will), das er gemeinsam mit Ngũgĩ wa Miiri geschrieben hat. Das Stück war eine Antwort auf einen Aufruf von der Gemeinschaft in Kamiirithu, die sich vom auf Englisch geschriebenen Theater entfremdet gefühlt hat. Um das Stück zu entwickeln, arbeiteten die zwei Autor*innen mit der Gemeinschaft und nutzten dabei nicht nur die lokale Sprache, sondern erlaubten auch kontinuierlichen Input, der von Realität des Alltagsleben der Menschen beeinflusst wurde. Das Theaterstück wurde von lokalen Stimmen geprägt, wobei die Fähigkeit, das Leben zu verkörpern, die wichtigste Qualifikation war. Dieser Ansatz beeinflusste den Stil, die Charaktere, den Ton und sogar den sich entwickelnden Casting-Prozess. Dies resultierte in einem Theater, welches er als näher an der Dialektik des Lebens als an Poesie oder Fiktion lobt.[3]
Und dennoch ist auch Jahre später Englisch noch das Höchste. Wir mixen all unsere lokalen Tendenzen hinein, wir improvisieren, und trotzdem… Wozu sonst sollte sich ein Volk entschließen, das auf Englisch unterrichtet wird? Viele Kenianer*innen werden Ihnen von der ‚Disc‘ erzählen. Dies kann ein kleines, oder in anderen Schulen ein großes, Stück Holz sein, das man sich um den Hals hängt. Die Disc wird der Person gegeben, die in einer anderen Sprache außer Englisch sprach; die Person reicht sie der nächsten Person, die sie hört, und so weiter. Am Ende des Tages, wird die Kette zurückverfolgt und jede Person, die die Disc bekommen hatte, wird bestraft. Ngũgĩ schrieb darüber, dass dies in den 1950ern passierte. Ich habe es in den 2000ern und 2010ern erlebt.
Ngũgĩ. Zeichnung von Alfred Wango mit freundlicher Genehmigung. © Alfred Wango
Ngũgĩ, das ist immer noch gängige Praxis.
In Black Skin, White Masks (Schwarze Haut, Weiße Masken) verspottet Frantz Fanon uns: „Ein Mensch, der eine Sprache hat, besitzt folglich die Welt, die durch diese Sprache ausgedrückt und impliziert wird.“[4] Englisch das ganze Leben zu sprechen garantiert den kenianischen Student*innen, die einst durch die Kette der Disc betraft wurden, keinen uneingeschränkten Zugang zum Vereinigten Königreich. Trotz ihrer Bestnoten in Englisch aus der Schule müssen sie sich Sprachtests unterziehen, um eine Universität im Vereinigten Königreich zu besuchen.
Mein Vater lobte oft Königin Elizabeth II. Elizabeth, genau wie der Name meiner Mutter. Seine Loyalität dem Königshaus gegenüber ist ein Anzeichen für die auseinanderstrebenden Meinungen der unterschiedlichen Generationen. Er sagt, sie sei elegant, ich sage, sie sei eine Kolonisatorin. Er erinnert sich an Stipendien, ich denke an Gatekeeping. Elizabeth, als Königin oder Mutter, war jemand in unseren Köpfen.
Als ich mit den Autor*innen des NMT zusammensaß und über die Notlage von Muttersprachen nachdachte, sagte ich schließlich resigniert: „Englisch ist meine Muttersprache, die Queen ist meine Mutter.“
Sprache, Muttersprachen, war die erste Frage.
II. Eine formwandelnde Sprache gewinnt Verbündete
Es ist 2023. Ich bin zum ersten Mal in München für eine dreimonatige Künstler*innen-Residenz; zum ersten Mal in Europa; und zum ersten Mal in einer Stadt, in der die Hauptsprache der Anweisungen eine Sprache ist, die ich nicht kenne. München ist ebenfalls in Bayern, wo „Guten Morgen, Tag, Abend,“ oft mit „Servus“ ersetzt wird. Nur eine Person in der S-Bahn hat zu mir „Auf Wiedersehen“ gesagt. Stattdessen habe ich gelernt „Tschüss“ oder „Ciao“ zu sagen und mir zu merken, dass der deutsche Äquivalent tatsächlich „Tschau“ geschrieben wird!
Zum Ende meines dritten Monats in München, bekam ich Heimweh. Aber die Symptome waren kein Verlangend nach dem Land Kenia. In der S-Bahn sagt die Durchsage „Nächster Halt…“ und wiederholt dies wieder und wieder bei allen Haltestellen sodass ich gereizt werde. Das unerklärliche Verlangen war das Deutsch, dass mich verzehrte:
Der Kassierer spricht mit einem weißen Mann auf Englisch aber antwortet mir auf Deutsch, obwohl er klar bemerkt, dass ich ihn nicht verstehe.
In einer regnerischen Nacht fährt die S-Bahn nicht und es fällt mir schwer ein Taxi zu bekommen, bis auf das Letzte. Kein Taxifahrer hat die Geduld mir zu sagen, was ihr letzter Halt ist. Irgendwie war der Letzte der Freundlichste.
Der Mann im Vodafone-Shop weigert sich, mich zu bedienen.
Und ja! Jemand hatte mir bereits gesagt: „Das ist Deutschland, sprich Deutsch!“
Was ist diese Feindseligkeit in der Sprache? Ich wollte Kiswahili mit Englisch gemixt hören, ich wollte den kenianischen Akzent hören, ich sehnte mich nach der kenianischen Art zu sprechen. Das Heimweh war ein vielschichtiger Ausbruch von Schmerz aufgrund anhaltender Mikro-Agressionen. Ich musste einen Preis zahlen, denn es lohnt sich, sich an die Sprache der Orte anzupassen, an denen man gesehen werden will. Niemand fragt mich, ob ich meine Muttersprache gelernt habe. Tatsächlich verlangen sie von mir, eine andere europäische Sprache zu erlernen. Aus Trotz gegen diese sprachliche Gewalt habe ich nie Deutsch gelernt. Als ich endlich auf dem Flughafen zuhause landete, verspürte ich eine tiefe Erleichterung.
Ngũgĩ, was habe ich dieser Welt zu erzählen, die mich, um in ihr zu existieren, weiter von meiner Sprache wegschiebt?
2024 begannen wir endlich mit der Arbeit an unserer internationalen Kollaboration. Bei der Entwicklung meiner Figure Pete, lies ich die Wiedersprüche der Afrikaner*innen in Bewegung in sie einfließen.
Petes Herkunft basiert auf Afrikanischer Migration auf der Suche nach Chancen. Sie wandelt sich und ändert ihr Auftreten zu dem, was die Situation verlangt. Wir werden oft an diesen afrikanischen Fleiß erinnert bevor wir das Haus unserer Eltern verlassen: „Du musst dort hingehen und dreimal so hart arbeiten, um dieselben Möglichkeiten zu erhalten.“ Anders als ich, verschwendet Pete keine Zeit mit Trotz, sondern schwört stattdessen auf die Meritokratie. Daher spricht Pete Deutsch als sie die deutsche Figur Katharina trifft.
Pete weiß, dass Sprache ein Schlüssel zur Seele ist. Während des Theaterstücks, wandelt sie durch Englisch, Kiswahili, Ekegusii und Deutsch. Ihre Absicht ist es, mehr und mehr Chancen in der Welt zu finden, mit allen Mitteln Reichtum aufzubauen. Für Pete ist das Erlernen einer neuen Sprache eine kleine Unannehmlichkeit auf dem Weg zu einer größeren Belohnung. Ob es das Wechseln zwischen verschiedenen Sprachcodes oder das Perfektionieren des richtigen Akzents ist, Pete strebt danach, sich an die Welt anzupassen, in der sie sich bewegt.
Und indem ich sie schrieb, brachte Pete mir Deutsch bei.
Pete veranschaulicht eine bedauernswerte Wahrheit: Sprache geht oft der Wahrnehmung voraus.
Ngũgĩ, meine Stimme kämpft dafür, dass mein Gesicht gesehen wird.
Die sich wandelnde Stimme, die nicht nur verschiedene Sprachen spricht, sondern auch verschiedene Register anwenden und sich in den verschiedenen Sphären des Lebens entsprechend präsentieren kann, ist eine gut erlernte Rüstung. In gewisser Weise findet eine Akkulturation statt, die die Spaltung der schwarzafrikanischen Persönlichkeit fördert. Wie Pete Achile Mbembe zitiert: „Wie eine Art riesiger Käfig ist die schwarze Vernunft in Wahrheit ein kompliziertes Netzwerk aus Verdopplung, Unsicherheit und Zweideutigkeit, das mit der Rasse als Gerüst aufgebaut ist.“[5]
Die Akzeptanz der Komplikationen von Sprache und der Verlust der Mehrsprachigkeit zugunsten europäischer Sprachen waren eine starke Grundlage für den von uns entwickelten Text. Wir entschieden uns für eine Veränderung und erlaubten den Figuren miteinander zu sprechen wie sie es gewöhnt sind. Wir fordern das Publikum auf, sich auf die Struktur unbekannter Sprachen einzulassen.
Dies ist besonders in Kenia so, wo es nicht üblich ist, Übertitel zu haben. Ich freue mich darauf, zu erfahren wie das Publikum dies erlebt, da viele von ihnen noch nie Theater mit Übertiteln gesehen haben. Normerweise geht man nicht zu Stücken, bei denen man die Sprache nicht versteht. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Schreiben: wenn ich die Sprache nicht spreche, schreibe ich sie nicht.
Zum ersten Mal übersetzte ich einen Text nach Ekegusii. Zum ersten Mal spreche ich Ekegusii in der Öffentlichkeit.
Ngũgĩ, Pete hat mir meine verlorene Muttersprache beigebracht.
III. THIS PLOT IS NOT FOR SALE
Wenn man sich in Kenia bewegt, sieht man oft die Worte ‚THIS PLOT IS NOT FOR SALE‘ (‚DIESES GRUNDSTÜCK STEHT NICHT ZUM VERKAUF‘[6]) groß auf einer Wand gemalt oder auf einem kleinen Schildern neben einem Tor. Dies ist kein Zeichen von Sorgfalt seitens der Grundstückeigentümer*innen, sondern ein Hinweis auf einen vorausgegangene Betrugsversuche, bei denen Hochstapler versuchen Grundstücke zu verkaufen, die ihnen nicht gehören.
Unser Projekt begann unter dem Arbeitstitel ‚Land of Tropes‘ (‚Land der Tropen‘) mit einem Fokus darauf, Stereotypen und Klischees zu untersuchen, denen wir uns gegenseitig in Bildern aussetzen. Die Figuren Pete (aus Kenia) und Kathi (aus Deutschland) nehmen erwartete Haltungen zu Kolonisation ein. Währenddessen entwickelt die dritte Figur, Stevan (aus dem ehemaligen Jugoslawien) eine ungewöhnliche Zwischenform ein, die von der Bewegung der Blockfreien Staaten beeinflusst ist, in der Jugoslawien sich mit den ehemals kolonisierten Staaten solidarisierte. Stevan, der ein Fotograf ist, steht im Mittelpunkt des Entstehungsprozesses dieser Bildreproduktion.
Durch Stevans absurdes Fotostudio, entsteht Satire und die Widersprüche ihrer Welt treten an die Oberfläche. Pete und ihr deutsches Gegenüber Kathi bauen mit ihrer gut gemeinten, klischeeartigen NGO eine unlogische Welt auf. Wir sehen, wie Pete um Raum verhandelt und auf ihrer Mehrsprachigkeit aufbaut. Aber das geht über ihre Sprache und ihren Körper hinaus, ihr Schweigen ist immer vielschichtig.
Für Pete bedeutet die Verantwortungen schwarzer Afrikaner*innen eine Last an Stereotypen, die ihrer Persönlichkeit aufgedrückt werden und durch harte Arbeit losgeworden werden können. Pete erscheint mit diesen Klischees, die an ihr haften. Sie ist beeinflusst von der schwierigen Zwischenposition, in der die Mittelschicht die aufgedrückten Klischees zu ihrem Vorteil über jene nutzen kann, die ihr Wissen überschätzen.
In Anerkennung dieser Dilemmas, änderte sich der Titel zu ‚THIS PLOT IS NOT FOR SALE.‘ Ein Aha-Moment im Schreibprozess. Der Titel erfasst das Vorgehen der Figuren, die beispielhaft für die Position stehen, kontinuierlich ideologischen Platz im Raum zu verhandeln. Diese Spannung zwingt sie dazu, ihre Wahrheit zu verstecken.
Die Schwere des kontinuierlichen Rollenspiels ist ein Geist in Petes Leben. Vor Stevans Kamera realisiert sie, dass die Wahrheit der einzige Weg ist, um aus dem Klischee zu entkommen, das ihr von dieser Bildreproduktion aufgezwungen wurde. Pete muss in gewisser Weise aufhören die Form zu verändern, akzeptieren wo sie herkommt und sich den Problemen stellen, die sie selbst aufrechterhält. Ihre Wahrheit kommt ans Licht, wenn sie Ekegusii spricht. Pete ehrt die postkolonialen Sprachargumente von Ngũgĩ.
Ngũgĩ, habe ich einige Tränen deiner neokolonialen Klage getrocknet?[7]
Letztendlich entspricht das Theaterstück nicht komplett Ngũgĩs Perspektive aber ist ein Startpunkt. Es hinterfragt, wie Sprache als Mittel zur Legitimierung genutzt wird und den Preis, der dafür gezahlt werden muss. ‚THIS PLOT IS NOT FOR SALE‘ fordert seine Figuren dazu auf, die Fassade fallen zu lassen.
Die Zusammenarbeit hat neue Türen zu Fragen aufgeworfen und aufregende Möglichkeiten für meine Performance in Ekegusii, Deutsch, Englisch und Kiswahili eröffnet. Die Magie dieser Erforschung und die Verlagerung dieser Sprachen in neue Räume ist nur in dieser ungewöhnlichen Konstellation an Autor*innen möglich.
Wie Pete, bin auch ich letztendlich mit vielen Sprachen überhäuft und auf der Suche nach dem Sinn. In jedem Moment auf der Suche nach einer Stimme. Auswählend, verwerfend, hinterfragend.
[1] 2018 erschien erstmals die deutsche Übersetzung Dekolonisierung des Denkens.
[2] Ngũgĩ wa Thiong’o, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature (London: James Currey, 1986), 27.
[3] Ngũgĩ, Decolonising the Mind, 54.
[4] Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, trans. Charles Lam Markmann (London: Pluto Press, 1986), 18.
[5] Achille Mbembe, Critique of Black Reason, trans. Laurent Dubois (Durham, NC: Duke University Press, 2017), 10.
[6] ‚Plot‘ in diesem Kontext bezeichnet ein Stück Land, kann aber auch die Handlung einer Geschichte bedeuten.
[7] Decolonising the Mind, Preface, xii