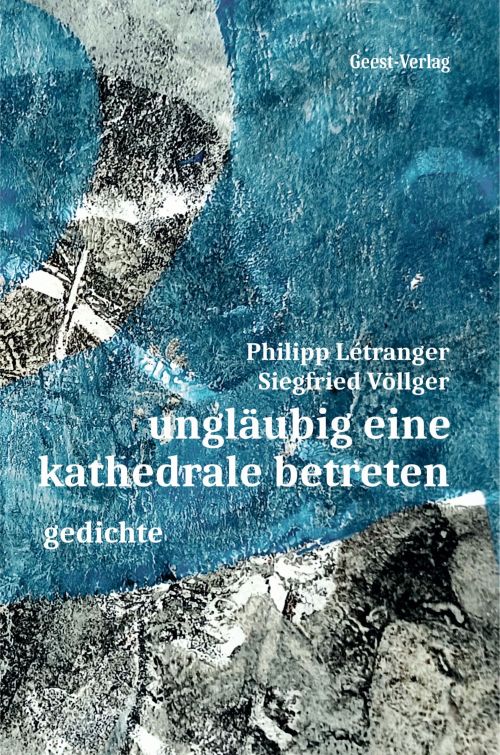Rezension zu Philipp Létrangers und Siegfried Völlgers dialogischem Lyirkprojekt: „ungläubig eine kathedrale betreten“
Der intertextuelle Beziehungsreichtum von Lyrik zeigt sich jüngst etwa im Gedichtband ungläubig eine kathedrale betreten der beiden Lyriker ![]() Philipp Létranger (München) und Siegfried Völlger (Augsburg), deren Gedichte in poetische Inspirationsbezüge treten. Der Lyriker Jürgen Bulla hat diesen Band für das Literaturportal Bayern gelesen.
Philipp Létranger (München) und Siegfried Völlger (Augsburg), deren Gedichte in poetische Inspirationsbezüge treten. Der Lyriker Jürgen Bulla hat diesen Band für das Literaturportal Bayern gelesen.
*
Der im Geest-Verlag erschienene Gedichtband von Philipp Létranger und Siegfried Völlger enthält je vierzig Gedichte beider Autoren, die in acht Abschnitten angeordnet, und in stetem Wechsel aufeinander bezogen sind, wobei schon im Vorwort darauf hingewiesen wird, dass kein Gedicht auf ein anderes antworten wolle. Vielmehr lassen sich die Texte nach Auskunft der Autoren nur von einzelnen Worten oder Bildern gegenseitig inspirieren und legen dabei Wert darauf, auch allein stehen zu können. Durchaus kunstvoll erscheint die Komposition der acht Kapitel, ergeben ihre Überschriften doch im Ganzen schon ein eigenes Gedicht:
tanz mit dem zweifel / gott schweigt / das seelenretten hat sich sehr verändert / die nicht warten wollten bis zum jüngsten tag / unterwegs mit dem achtsamkeitsfähnchen / fehlt nicht viel vom albtraum zum leben / wenn einmal einer wagen wird die götter einzusammeln / bleibt nichts als weiter zu schreiben
Leise Töne in ruhigem Gedankenstrom
Hinsichtlich des Tonfalls ist dem Sprecher-Ich beider Autoren eine Neigung zu eher leisen und lakonischen Tönen gemeinsam, bei gelegentlicher Annäherung an eine tagebuchartige Diktion („langer spaziergang heute / über wiesen / an wiesenrändern, auf waldwegen / viel zu sehen“, S. 40), gelegentlich auch mit einem leicht pädagogischen Impetus: „wenn wir den göttern / gleichtun wollen // müssen wir schweigen lernen“, S. 23).
Die freirhythmisch gestalteten, in konsequenter Kleinschreibung gehaltenen Gedichte sind meist in unterschiedlich lange Strophen unterteilt und verzichten weitestgehend auf Zeichensetzung, was dem Gedankenstrom von einem Vers zum andern, aber auch von einem Gedicht zum andern in seinem Fluss hilfreich sein mag. Selten finden sich Überschriften (z.B. „nahverkehrt“, S. 43), die dann schon als Teil des betreffenden Gedichts gelesen werden können.
Bewahrung des Zerbrechlichen
Inhaltlich befassen sich die Texte mit zeitlosen Themen wie dem schwer greifbaren Phänomen der Freiheit: „es sind hinweise gestreut / zarte zugegeben / auf die idee der freiheit“ (Létranger, S. 19).
Das mitunter schwierige Miteinander in menschlichen Beziehungen kommt öfters zu Wort: „wenn es ums streiten geht (…) / in der stille / die auf den scherben der worte liegt (…) / irgendwann / musst du kehren (Létranger, S. 61). Das Unterwegssein in Bussen, in Zügen, die Reise, vielleicht die Lebensreise, die Haltlosigkeit des Getriebenen wird ebenfalls thematisiert (z.B. Létranger, S. 43, Völlger, S. 53).
Auch poetologische Aspekte fließen immer wieder ein: „auch das gedicht / lässt dich im stich / oft erst spät …“ (Völlger, S. 16), „nimm beispielsweise ein gedicht / du machst dir ein bild davon / und hängst es an die pinnwand / aber bleiben / kann es da nicht …“ (Létranger, S. 17), „eine vorübergehende aufregung / der lüfte kurzes verhuschtes geflacker / im neuronenwald // mehr sind gedichte nicht / kannst du denken – doch vielleicht …“ (Létranger, S. 100).
Die Überlegungen zur Haltbarkeit von Gedichten in einer materiell geprägten Welt reihen sich in eine große Tradition ein, zu deren exponierten Vertretern u.a. Peter Rühmkorf gehört, und sie geben vielen Gedichten von Létranger und Völlger eine liebenswerte Hinfälligkeit, die umso mehr zur Bewahrung der gefundenen Worte aufzurufen scheint.
Endlichkeit oder Dauer?
Als dominantestes Thema der Sammlung erweist sich jedoch die Frage nach der menschlichen Existenz, ihrer vordergründig verneinten und hintergründig wohl doch erhofften Dauerhaftigkeit, wie schon das titelgebende Gedicht Siegfried Völlgers in seiner zunächst widersprüchlich wirkenden Formulierung anklingen lässt: „ungläubig eine kathedrale betreten / nur farben zu finden / formen, bedürftige, wissen / und oft eine anwesenheit (…) / ist das ein / kathedralengedanke? / soll ich mich mehr, / weiter hineinwagen? …“ (S. 90).
Die Ungläubigkeit im doppelten Sinne, die vorsichtige Annäherung des Ungläubigen an die Fragen des Glaubens und das ungläubige Staunen über die Pracht der Kirchenausstattung, öffnen sanft eine Tür zur verworfenen Vorstellung von der Transzendenz. Dann wieder wird eben diese Vorstellung in ein leicht spöttisch anmutendes Licht gerückt:
„… am zeitenende / wirds einen fetten stau geben / vor dem haupteingang / zum himmel (…) alle anderen sind schon da / die dauerkartenbesitzer / und die / die nicht warten wollten / bis zum jüngsten tag“ (Létranger, S. 46). „… wir anderen / sehen uns dann nicht mehr / es sei denn / wir wären arm / und hätten ein kamel / mit dem wir ankommen“ (Völlger, S. 47).
Es sind die Verse von neugierig Zweifelnden, die diesen Gedichtband prägen.
Naturbilder und Neologismen
Die Sprache beider Autoren greift in ihrer Bildhaftigkeit neben der Opposition von Himmel und Hölle und einigen Stadtmotiven vor allem Motive aus Flora und Fauna auf: Gärten, Seen, Vögel und exotischere Tiere, Steine. Neben den überwiegend visuellen Eindrücken tragen jedoch auch auditive Wahrnehmungen und Gerüche zur Vielfalt der sinnlichen Wahrnehmung in den vorliegenden Gedichten bei. Immer wieder, wenn auch mit viel Bedacht eingesetzt, finden sich außerdem Neologismen, mehrsilbige Komposita wie etwa das „achtsamkeitsfähnchen“ (S. 56) oder der „hohlkopfräuber“ (S. 59), die die insgesamt eher sanft reflektierende Wortwahl ein wenig aufrütteln.
Die Gedichte von Philipp Létranger und Siegfried Völlger öffnen in ihrer thematischen Vielfalt und ihrer eindringlichen Bildhaftigkeit einen beeindruckenden lyrischen Kosmos, der zwischen Natur und Stadt, gestern, heute und morgen, Diesseits und Jenseits changiert. Was im Vorwort angekündigt wird, bewahrheitet sich: Neben den isoliert lesbaren Gedichten beider Autoren ergibt sich gleichsam ein dritter, im Zusammenspiel der beiden Sammlungen entstehender Gesamttext.
Rezension zu Philipp Létrangers und Siegfried Völlgers dialogischem Lyirkprojekt: „ungläubig eine kathedrale betreten“
Der intertextuelle Beziehungsreichtum von Lyrik zeigt sich jüngst etwa im Gedichtband ungläubig eine kathedrale betreten der beiden Lyriker ![]() Philipp Létranger (München) und Siegfried Völlger (Augsburg), deren Gedichte in poetische Inspirationsbezüge treten. Der Lyriker Jürgen Bulla hat diesen Band für das Literaturportal Bayern gelesen.
Philipp Létranger (München) und Siegfried Völlger (Augsburg), deren Gedichte in poetische Inspirationsbezüge treten. Der Lyriker Jürgen Bulla hat diesen Band für das Literaturportal Bayern gelesen.
*
Der im Geest-Verlag erschienene Gedichtband von Philipp Létranger und Siegfried Völlger enthält je vierzig Gedichte beider Autoren, die in acht Abschnitten angeordnet, und in stetem Wechsel aufeinander bezogen sind, wobei schon im Vorwort darauf hingewiesen wird, dass kein Gedicht auf ein anderes antworten wolle. Vielmehr lassen sich die Texte nach Auskunft der Autoren nur von einzelnen Worten oder Bildern gegenseitig inspirieren und legen dabei Wert darauf, auch allein stehen zu können. Durchaus kunstvoll erscheint die Komposition der acht Kapitel, ergeben ihre Überschriften doch im Ganzen schon ein eigenes Gedicht:
tanz mit dem zweifel / gott schweigt / das seelenretten hat sich sehr verändert / die nicht warten wollten bis zum jüngsten tag / unterwegs mit dem achtsamkeitsfähnchen / fehlt nicht viel vom albtraum zum leben / wenn einmal einer wagen wird die götter einzusammeln / bleibt nichts als weiter zu schreiben
Leise Töne in ruhigem Gedankenstrom
Hinsichtlich des Tonfalls ist dem Sprecher-Ich beider Autoren eine Neigung zu eher leisen und lakonischen Tönen gemeinsam, bei gelegentlicher Annäherung an eine tagebuchartige Diktion („langer spaziergang heute / über wiesen / an wiesenrändern, auf waldwegen / viel zu sehen“, S. 40), gelegentlich auch mit einem leicht pädagogischen Impetus: „wenn wir den göttern / gleichtun wollen // müssen wir schweigen lernen“, S. 23).
Die freirhythmisch gestalteten, in konsequenter Kleinschreibung gehaltenen Gedichte sind meist in unterschiedlich lange Strophen unterteilt und verzichten weitestgehend auf Zeichensetzung, was dem Gedankenstrom von einem Vers zum andern, aber auch von einem Gedicht zum andern in seinem Fluss hilfreich sein mag. Selten finden sich Überschriften (z.B. „nahverkehrt“, S. 43), die dann schon als Teil des betreffenden Gedichts gelesen werden können.
Bewahrung des Zerbrechlichen
Inhaltlich befassen sich die Texte mit zeitlosen Themen wie dem schwer greifbaren Phänomen der Freiheit: „es sind hinweise gestreut / zarte zugegeben / auf die idee der freiheit“ (Létranger, S. 19).
Das mitunter schwierige Miteinander in menschlichen Beziehungen kommt öfters zu Wort: „wenn es ums streiten geht (…) / in der stille / die auf den scherben der worte liegt (…) / irgendwann / musst du kehren (Létranger, S. 61). Das Unterwegssein in Bussen, in Zügen, die Reise, vielleicht die Lebensreise, die Haltlosigkeit des Getriebenen wird ebenfalls thematisiert (z.B. Létranger, S. 43, Völlger, S. 53).
Auch poetologische Aspekte fließen immer wieder ein: „auch das gedicht / lässt dich im stich / oft erst spät …“ (Völlger, S. 16), „nimm beispielsweise ein gedicht / du machst dir ein bild davon / und hängst es an die pinnwand / aber bleiben / kann es da nicht …“ (Létranger, S. 17), „eine vorübergehende aufregung / der lüfte kurzes verhuschtes geflacker / im neuronenwald // mehr sind gedichte nicht / kannst du denken – doch vielleicht …“ (Létranger, S. 100).
Die Überlegungen zur Haltbarkeit von Gedichten in einer materiell geprägten Welt reihen sich in eine große Tradition ein, zu deren exponierten Vertretern u.a. Peter Rühmkorf gehört, und sie geben vielen Gedichten von Létranger und Völlger eine liebenswerte Hinfälligkeit, die umso mehr zur Bewahrung der gefundenen Worte aufzurufen scheint.
Endlichkeit oder Dauer?
Als dominantestes Thema der Sammlung erweist sich jedoch die Frage nach der menschlichen Existenz, ihrer vordergründig verneinten und hintergründig wohl doch erhofften Dauerhaftigkeit, wie schon das titelgebende Gedicht Siegfried Völlgers in seiner zunächst widersprüchlich wirkenden Formulierung anklingen lässt: „ungläubig eine kathedrale betreten / nur farben zu finden / formen, bedürftige, wissen / und oft eine anwesenheit (…) / ist das ein / kathedralengedanke? / soll ich mich mehr, / weiter hineinwagen? …“ (S. 90).
Die Ungläubigkeit im doppelten Sinne, die vorsichtige Annäherung des Ungläubigen an die Fragen des Glaubens und das ungläubige Staunen über die Pracht der Kirchenausstattung, öffnen sanft eine Tür zur verworfenen Vorstellung von der Transzendenz. Dann wieder wird eben diese Vorstellung in ein leicht spöttisch anmutendes Licht gerückt:
„… am zeitenende / wirds einen fetten stau geben / vor dem haupteingang / zum himmel (…) alle anderen sind schon da / die dauerkartenbesitzer / und die / die nicht warten wollten / bis zum jüngsten tag“ (Létranger, S. 46). „… wir anderen / sehen uns dann nicht mehr / es sei denn / wir wären arm / und hätten ein kamel / mit dem wir ankommen“ (Völlger, S. 47).
Es sind die Verse von neugierig Zweifelnden, die diesen Gedichtband prägen.
Naturbilder und Neologismen
Die Sprache beider Autoren greift in ihrer Bildhaftigkeit neben der Opposition von Himmel und Hölle und einigen Stadtmotiven vor allem Motive aus Flora und Fauna auf: Gärten, Seen, Vögel und exotischere Tiere, Steine. Neben den überwiegend visuellen Eindrücken tragen jedoch auch auditive Wahrnehmungen und Gerüche zur Vielfalt der sinnlichen Wahrnehmung in den vorliegenden Gedichten bei. Immer wieder, wenn auch mit viel Bedacht eingesetzt, finden sich außerdem Neologismen, mehrsilbige Komposita wie etwa das „achtsamkeitsfähnchen“ (S. 56) oder der „hohlkopfräuber“ (S. 59), die die insgesamt eher sanft reflektierende Wortwahl ein wenig aufrütteln.
Die Gedichte von Philipp Létranger und Siegfried Völlger öffnen in ihrer thematischen Vielfalt und ihrer eindringlichen Bildhaftigkeit einen beeindruckenden lyrischen Kosmos, der zwischen Natur und Stadt, gestern, heute und morgen, Diesseits und Jenseits changiert. Was im Vorwort angekündigt wird, bewahrheitet sich: Neben den isoliert lesbaren Gedichten beider Autoren ergibt sich gleichsam ein dritter, im Zusammenspiel der beiden Sammlungen entstehender Gesamttext.