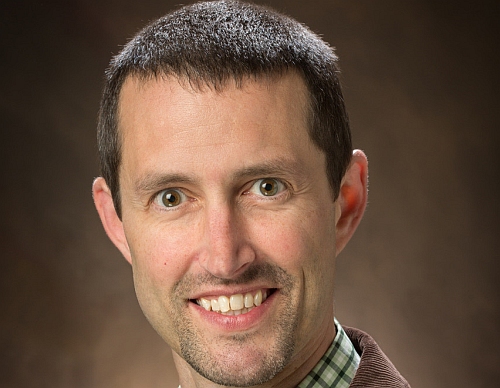Kulturelle Aneignung im Interview mit George Ironstrack
Zur Winnetou-Debatte in den USA, der Problematik der künstlerischen Befassung mit indigenen Kulturen allgemein und der Modernisierung einer lange unterdrückten Sprache sprach die Autorin Tanja Dückers mit dem Lehrer George Ironstrack über das Volk der Miami.
*
George Ironstrack (*1975) hat seit Ende der 1990er-Jahre als Student wie auch als Lehrer an Projekten zur Erneuerung der Sprache der Miami teilgenommen. Im Juli 2008 kam er als stellvertretender Direktor und Bildungskoordinator zum Myaamia Center. George Ironstrack ist Bürger der indigenen Gemeinschaft der Miami von Oklahoma. Er erwarb den Master of Arts in „Ursprünge und Geschichte der Vereinigten Staaten“ von der Miami University in Oxford, Ohio. Ebendort lebt Geroge Ironstrack.
Tanja Dückers (*1968 in Berlin) hat 18 Bücher veröffentlicht, darunter die Prosawerke Himmelskörper, Spielzone, Hausers Zimmer, Café Brazil, Essaybände (Morgen nach Utopia, Über das Erinnern), Lyrikbände, Kinderbücher sowie Theaterstücke. Sie äußert sich zu gesellschaftspolitischen Themen und ist auf vielen Podien im In- und Ausland vertreten. Dückers war writer-in-residence u.a. am Dartmouth College, Allegheny College, Oberlin College sowie an der Miami University. 2020 lehrte sie an der Madison University. Sie ist Mitglied im PEN, bei Amnesty International, bei Weiter Schreiben und lebt mit ihrer Familie in Berlin.
**
TANJA DÜCKERS: Was denken Sie über Winnetou?
GEORGE IRONSTRACK: Meine Antworten spiegeln natürlich nur meinen persönlichen Standpunkt wider. Ich bin ein Bürger der Miami, einer indigenen Gemeinschaft, die historisch gesehen aus dem heutigen Ohio, Indiana und Illinois stammt, aber zweimal gewaltsam vertrieben wurde.
Was Winnetou betrifft, so bin ich, wissen Sie, keineswegs ein Experte. Ich komme nicht aus der Literatur, ich bin studierter Historiker.
Also ein Problem ist, dass und wie Winnetou als Apache dargestellt wird. Die Darstellung der ihn umgebenden Kultur, seiner Sprache, auch Details von Winnetous Auftreten selber, das hat alles wenig damit zu tun. Das ist ein Phänomen, das einem öfter in euro-amerikanischen Kulturen begegnet: Es werden sehr generische Darstellungen von Ureinwohnern kreiiert, die dann zwar mit spezifischen Namen wie Apache versehen werden, aber in keiner Weise zutreffend sind. Es wird eher eine allgemeingültige Vorstellung wiedergegeben, ohne dies deutlich zu machen. Solche Darstellungen ignorieren die große Vielfalt der nordamerikanischen Ureinwohner. Es gibt 500 Stämme in den Vereinigten Staaten und noch viele mehr in Kanada und Mexiko: also eine riesige Menge an Kulturen, Sprachen und politischen Systemen. Und viele dieser frühen Darstellungen in der Populärkultur löschen diese Unterschiede aus. Diese populärkulturellen Darstellungen können, wenn sie heute konsumiert werden, meiner Meinung nach dem Verständnis der Menschen schaden.
Die Bücher und Filme von Karl May kann man sicher nicht als wissenschaftliche Auskunft darüber verstehen, wie indigene Nordamerikaner*innen gelebt haben. Sie erheben nicht den Anspruch, Fakten zu liefern. Aber natürlich wurden und werden sie von vielen Menschen gelesen und gesehen, prägen Einstellungen und Vorurteile. Wie ist Ihr Standpunkt hier? Was denken Sie über die „Freiheit der Kunst“?
Das ist eine wirklich gute Frage. Und, ja, ich möchte hier vorsichtig sein. Ich glaube nämlich schon, dass die Leute heute die Freiheit haben, zu machen, was sie wollen. Aber das bedeutet nicht, dass sie es ohne Konsequenzen machen können. Wenn sie sich also dafür entscheiden, Kunst zu machen, die indigene Themen behandelt, aber die Indigenen nicht hierbei einbeziehen, werden sie wahrscheinlich grobe Fehler machen. Wie bei Winnetou geschehen. Und dann werden sie viel Kritik einstecken müssen. Und die Leute können das Cancel-Culture nennen, ich nenne es einfach Konsequenzen.
Hier in den USA und in Kanada gibt es immer mehr Filme, die von Indigenen über Indigene gemacht werden. Das heißt nicht, dass man nicht auch ohne diesen Hintergrund Bücher oder Drehbücher über Indigene schreiben kann. Zum Glück werden dabei immer öfter indigene Nordamerikaner*innen konsultiert. Damit werden Stereotype eher vermieden.
Niemand kann jemanden davon abhalten zu schreiben oder eine Kamera in die Hand zu nehmen. Aber wenn wir populäre Kunst über Indigene machen wollen, brauchen wir Beratung, denn die meisten Non-Natives haben nicht genug Wissen über eine bestimmte Gruppe, um ein Kunstwerk über sie zu schaffen. Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, aber das ist mein Eindruck.
Was halten Sie von Filmen über indigene Nordamerikaner*innen, in denen diese nicht als Schauspieler*innen mitwirken?
Hier in den Vereinigten Staaten und in Kanada gibt es mittlerweile eine klare Grenze, die man nicht überschreiten darf. Indigene Figuren müssen von indigenen Schauspieler*innen gespielt werden. Wir haben hier jedoch das Problem, dass es Leute gibt, die behaupten, indigen zu sein, es aber nicht sind. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Leute tatsächlich aus den Gemeinschaften kommen, aus denen sie zu kommen behaupten, was zum Glück gar nicht so schwer herauszufinden ist. Wir führen Zählungen über unsere Gemeinschaften durch, wir wissen, wer zu unseren Gemeinschaften gehört. Und selbst wenn jemand vielleicht kein politisches Mitglied ist, aber die genetische Abstammung hat, also blutsverwandt ist, ist das immer noch bekannt.
Ich finde es zwar wichtig, dass indigene Charaktere von indigenen Schauspieler*innen gespielt werden, aber eines der Probleme hier in den Vereinigten Staaten ist, dass wir nicht genügend professionell ausgebildete indigene Schauspieler*innen haben. Es fehlt an Geld und Zugang zu akademischen Institutionen. In Kanada finanziert die Regierung die Produktion von Fernsehserien und Filmen, das macht es einfacher für diejenigen, die weniger Geld in die Ausbildung stecken können.
In den USA haben wir nicht dasselbe System. Deshalb ist jeder Film, der in den USA mit indigenen Schauspieler*innen gedreht wird, eine Möglichkeit, die nächste Generation indigener Künstler*innen in unserer Gemeinschaft auszubilden. Wenn auch nur eine Rolle an einen Nicht-Indigenen verloren geht, bedeutet das, dass wir unser eigenes Talent als Gemeinschaft nicht entwickeln. Viele der Geschichten, die erzählt werden sollen, sind voll von unserem Schmerz, und dass Leute, die nicht zu unseren Gemeinschaften gehören, diese Geschichten erzählen, kommt mir und vielen anderen Menschen wie eine Verletzung vor.
Es ist sehr interessant, dass Sie den sozialen Aspekt mit Blick auf die indigenen Schauspieler*innen betonen. Der wird sonst in der Identitäts-Cancel-Culture-Debatte nie erwähnt. Wie beurteilen Sie denn die alten amerikanischen Westernfilme? Die amerikanischen Indigenen werden ja oft als böse Angreifer aus dem Hinterhalt dargestellt, die netten weißen Siedlern Schaden zufügen. Ich finde das Bild eigentlich noch problematischer als das in den Winnetou-Filmen transportierte, die Filme sind ja eher romantisierend.
Die älteren Western sind zutiefst problematisch. Wir werden fast nie als vollwertige Menschen dargestellt. Sicherlich gab es damals viele Kriege. Aber meist wird nicht thematisiert, wofür die Natives kämpften. Weil es ihre Heimat war, in die die Siedler eindrangen, nun ja, zuerst die US-Armee. Das war unbestelltes Land. Es gab keine Verträge, die besagten, dass dieses oder jenes Land aus Sicht der indigenen Gemeinschaften den Vereinigten Staaten gehörte. Die Darstellung ist flach und binär, zum Beispiel die vom Widerstand der „Wilden“ gegen die „Zivilisation“, wie sie von weißen Bürger*innen der USA repräsentiert wird. In den 1970er-Jahren gab es Versuche, das zu ändern. Aber mir scheint, dass sich erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts ein echter Wandel abzeichnete.
Dennoch: Auch heute noch werden in den USA Western gedreht, in denen der Schwerpunkt, was die Indigenen angeht, auf Gewalt und Tod liegt. Selbst die beste Erzählweise führt dazu, dass der Mythos vom Verschwinden der Natives fortbesteht, denn am Ende des Films sind meistens alle Indigenen tot. Es gibt uns aber noch. Auch wenn die Erzählung komplexer ist und Indigene in die Beratung mit einbezogen werden, bleibt oft diese Botschaft übrig. Also, ich denke, der Western an sich ist „anti-indigen“. Und es ist schwer, dieser Schublade in den Vereinigten Staaten zu entkommen.
Sie sind ein Experte für Bildung an der Miami University in Oxford, Ohio. Was denken Sie darüber, was amerikanischen Schüler*innen heute über die Geschichte Amerikas und den versuchten Genozid beigebracht wird?
Ich selbst war Lehrer an einer öffentlichen Schule und habe an der High School unterrichtet. Also... ich habe es also von innen erlebt. Und ich habe nach wie vor großen Respekt vor Lehrenden an öffentlichen Schulen. Ihnen wird hier in den Vereinigten Staaten eine Menge abverlangt. Leider werden die Schulen als Ort zur Lösung sozialer Probleme angesehen, weil wir nicht genug Unterstützung außerhalb der Schulen finanzieren, um die Bedürfnisse der Familien zu erfüllen. Was ich damit sagen will, ist, dass Lehrende in ihren Klassenzimmern auf eine Menge reagieren müssen. Aber in ihrer Ausbildung werden sie nicht genug darauf vorbereitet, über die indigenen Nordamerikaner*innen so zu sprechen, dass ihre Gemeinschaften heute sagen würden: „Ja, das ist gut. Das ist nuanciert, vielschichtig.“ Lehrende unterrichten oft nach inhaltlichen Standards, die der Staat vorschreibt. Leider gibt es nicht genügend Inhalte, die in Zusammenarbeit mit den indigenen Gemeinschaften entwickelt wurden. Es gibt einzelne Lehrende, die sich sehr bemühen. Aber sie sind die Ausnahme, scheint mir.
Sie haben drei Kinder. Wie nehmen Sie den Unterricht konkret bei ihnen jeweils wahr?
Ich besuche tatsächlich, obwohl ich einen Fulltime-Job habe, manchmal die Klassen meiner Kinder, weil ich möchte, dass ihre Klassenkamerad*innen ein Verständnis für die Miami-Gemeinschaft von heute haben. Es gibt einige Bundesstaaten in den USA, die bessere Arbeit leisten als andere, weil sie auf staatlicher Ebene Materialien erstellt haben. Und sie haben Bildungsmandate, die besagen, dass man über indigene Gemeinschaften unterrichten muss. Sie berichten über indigene Gemeinschaften nicht nur als historische Phänomene, im Geschichtsunterricht.
In Bundesstaaten wie Wisconsin oder Washington wird vorgeschrieben, dass die Kinder etwas über indigene Gemeinschaften als zeitgenössische politische und kulturelle Einheiten lernen müssen. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, denn wenn Kinder etwas über Deutschland in der Vergangenheit lernen, dann wissen sie, dass Deutschland heute noch existiert. Aber wenn sie etwas über die Miami-Gemeinschaft in der Vergangenheit lernen, wissen sie oft nicht, dass es uns heute noch gibt. Man muss also bei uns Indigenen wirklich von der Gegenwart ausgehend rückwärts unterrichten.
Es gibt hier an der Miami University auch einige Indigene.
An der Universität von Miami ist die Situation anders als landesweit, weil die Professor*innen viel mehr Freiheiten haben, ihre Lehrpläne zu gestalten. Und die Miami-Gemeinschaft auf dem Campus hat eine starke Präsenz. Wir haben 18 Mitarbeiter*innen in unserem Zentrum und einige Studierende aus unserer Gemeinschaft hier. Es wird mehr und mehr anerkannt, dass die Miami-Gemeinschaft eine moderne, lebendige Einheit ist.
Haben Sie das Gefühl, dass es an der Universität ein wachsendes Interesse an der Sprache der Miami gibt?
Was unsere Sprache, das Myaamiaataweenki, angeht, so arbeiten wir seit Ende der 1990er-Jahre daran, die Sprache wiederzubeleben. Das Interesse nimmt zu. Die Zahl der Kinder, die zumindest einen Teil unserer Sprache lernen, vergrößert sich. Wir sind jetzt auch in der Lage, Lehrende auszubilden. Wir brauchen mehr Sprachlehrende, weil es mehr Nachfrage gibt. Sobald wir selber mehr Lehrende hervorbringen, werden wir ein wirklich positives Wachstum in der Gemeinschaft erleben. Ich freue mich sehr darauf.
Wollen auch Menschen die Miami-Sprache lernen, die nicht zur Gemeinschaft gehören?
Ja, es gibt ein Interesse von Leuten, die nicht zur Miami-Gemeinschaft gehören, unsere Sprache zu lernen. Im Moment haben wir leider keine Möglichkeit, auf dieses Interesse einzugehen, weil wir bereits zu viel Nachfrage in unserer eigenen Gemeinschaft haben. Einen unserer Lehrer abzugeben, um Nicht-Indigene zu unterrichten, ist also etwas, was wir im Moment nicht tun können. Aber es ist etwas, das wir gerne tun würden. Wir haben kein Problem damit, dass Leute unsere Sprache lernen. Wir versuchen nicht, die Leute vom Lernen abzuhalten. Wir haben deshalb ein Online-Wörterbuch. Und hin und wieder werden wir von Leuten kontaktiert, die nur durch unser Online-Wörterbuch genug von der Sprache gelernt haben, um mit uns sprechen zu können. Da denke ich dann: „Wow, das ist cool. Ich kenne diese Person nicht, aber sie spricht meine Sprache.“
Ich habe in Ihrem Blog gelesen, dass ihre Gemeinschaft ein Wort für „Limonade“ gesucht hat. Mich interessiert, wie oft so etwas passiert? Und was sind die Kriterien für die Auswahl eines Neologismus?
Das ist eine schöne Frage. Wir denken gegenwartsbezogen, die Erneuerung und Aktualisierung unserer Sprache ist uns wichtig. Ich schätze, dass wir jeden bis jeden zweiten Monat ein neues Wort erfinden oder ein altes Wort für unsere heutigen Bedürfnisse umfunktionieren. Denn unsere Sprache ist ja im frühen 20. Jahrhundert eingeschlafen. Für alles, was danach im 20. Jahrhundert alles an Technologie entwickelt wurde, haben wir keine Namen. Deshalb müssen wir ständig neue Wörter erfinden, die unsere Vorfahren aufgrund der Unterdrückung der Sprache in der Zeit, in der all diese neuen Dinge entstanden sind, nicht entwickeln konnten. Normalerweise bin ich an diesem Prozess nicht beteiligt. Ich bin eher auf der Seite der Lehrenden, aber ich beobachte die E-Mail-Threads, in denen das Sprachteam Ideen austauscht. Am Ende wird ein neues Wort in unser Online-Wörterbuch aufgenommen.
Und was für ein Begriff wurde für „Limonade“ gefunden?
Unser Sprachteam nahm oonsaawimini für Zitrone (wörtlich: gelbe Beere) und fügte eine Endung hinzu, die „trinken“ oder „Saft“ bedeutet, um das Wort oonsaawiminaapowi = Limonade zu bilden.
Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Gibt es etwas, was Sie Ihrerseits noch anfügen möchten?
Was mir noch einfällt, ist, dass ich selbst deutsche Wurzeln habe. Meine Großmutter mütterlicherseits wurde in Deutschland geboren und sprach Deutsch. Und mein Ur-Ur-Großvater war Bayer. Es gibt also durchaus familiäre Bindungen nach Deutschland.
Kulturelle Aneignung im Interview mit George Ironstrack
Zur Winnetou-Debatte in den USA, der Problematik der künstlerischen Befassung mit indigenen Kulturen allgemein und der Modernisierung einer lange unterdrückten Sprache sprach die Autorin Tanja Dückers mit dem Lehrer George Ironstrack über das Volk der Miami.
*
George Ironstrack (*1975) hat seit Ende der 1990er-Jahre als Student wie auch als Lehrer an Projekten zur Erneuerung der Sprache der Miami teilgenommen. Im Juli 2008 kam er als stellvertretender Direktor und Bildungskoordinator zum Myaamia Center. George Ironstrack ist Bürger der indigenen Gemeinschaft der Miami von Oklahoma. Er erwarb den Master of Arts in „Ursprünge und Geschichte der Vereinigten Staaten“ von der Miami University in Oxford, Ohio. Ebendort lebt Geroge Ironstrack.
Tanja Dückers (*1968 in Berlin) hat 18 Bücher veröffentlicht, darunter die Prosawerke Himmelskörper, Spielzone, Hausers Zimmer, Café Brazil, Essaybände (Morgen nach Utopia, Über das Erinnern), Lyrikbände, Kinderbücher sowie Theaterstücke. Sie äußert sich zu gesellschaftspolitischen Themen und ist auf vielen Podien im In- und Ausland vertreten. Dückers war writer-in-residence u.a. am Dartmouth College, Allegheny College, Oberlin College sowie an der Miami University. 2020 lehrte sie an der Madison University. Sie ist Mitglied im PEN, bei Amnesty International, bei Weiter Schreiben und lebt mit ihrer Familie in Berlin.
**
TANJA DÜCKERS: Was denken Sie über Winnetou?
GEORGE IRONSTRACK: Meine Antworten spiegeln natürlich nur meinen persönlichen Standpunkt wider. Ich bin ein Bürger der Miami, einer indigenen Gemeinschaft, die historisch gesehen aus dem heutigen Ohio, Indiana und Illinois stammt, aber zweimal gewaltsam vertrieben wurde.
Was Winnetou betrifft, so bin ich, wissen Sie, keineswegs ein Experte. Ich komme nicht aus der Literatur, ich bin studierter Historiker.
Also ein Problem ist, dass und wie Winnetou als Apache dargestellt wird. Die Darstellung der ihn umgebenden Kultur, seiner Sprache, auch Details von Winnetous Auftreten selber, das hat alles wenig damit zu tun. Das ist ein Phänomen, das einem öfter in euro-amerikanischen Kulturen begegnet: Es werden sehr generische Darstellungen von Ureinwohnern kreiiert, die dann zwar mit spezifischen Namen wie Apache versehen werden, aber in keiner Weise zutreffend sind. Es wird eher eine allgemeingültige Vorstellung wiedergegeben, ohne dies deutlich zu machen. Solche Darstellungen ignorieren die große Vielfalt der nordamerikanischen Ureinwohner. Es gibt 500 Stämme in den Vereinigten Staaten und noch viele mehr in Kanada und Mexiko: also eine riesige Menge an Kulturen, Sprachen und politischen Systemen. Und viele dieser frühen Darstellungen in der Populärkultur löschen diese Unterschiede aus. Diese populärkulturellen Darstellungen können, wenn sie heute konsumiert werden, meiner Meinung nach dem Verständnis der Menschen schaden.
Die Bücher und Filme von Karl May kann man sicher nicht als wissenschaftliche Auskunft darüber verstehen, wie indigene Nordamerikaner*innen gelebt haben. Sie erheben nicht den Anspruch, Fakten zu liefern. Aber natürlich wurden und werden sie von vielen Menschen gelesen und gesehen, prägen Einstellungen und Vorurteile. Wie ist Ihr Standpunkt hier? Was denken Sie über die „Freiheit der Kunst“?
Das ist eine wirklich gute Frage. Und, ja, ich möchte hier vorsichtig sein. Ich glaube nämlich schon, dass die Leute heute die Freiheit haben, zu machen, was sie wollen. Aber das bedeutet nicht, dass sie es ohne Konsequenzen machen können. Wenn sie sich also dafür entscheiden, Kunst zu machen, die indigene Themen behandelt, aber die Indigenen nicht hierbei einbeziehen, werden sie wahrscheinlich grobe Fehler machen. Wie bei Winnetou geschehen. Und dann werden sie viel Kritik einstecken müssen. Und die Leute können das Cancel-Culture nennen, ich nenne es einfach Konsequenzen.
Hier in den USA und in Kanada gibt es immer mehr Filme, die von Indigenen über Indigene gemacht werden. Das heißt nicht, dass man nicht auch ohne diesen Hintergrund Bücher oder Drehbücher über Indigene schreiben kann. Zum Glück werden dabei immer öfter indigene Nordamerikaner*innen konsultiert. Damit werden Stereotype eher vermieden.
Niemand kann jemanden davon abhalten zu schreiben oder eine Kamera in die Hand zu nehmen. Aber wenn wir populäre Kunst über Indigene machen wollen, brauchen wir Beratung, denn die meisten Non-Natives haben nicht genug Wissen über eine bestimmte Gruppe, um ein Kunstwerk über sie zu schaffen. Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, aber das ist mein Eindruck.
Was halten Sie von Filmen über indigene Nordamerikaner*innen, in denen diese nicht als Schauspieler*innen mitwirken?
Hier in den Vereinigten Staaten und in Kanada gibt es mittlerweile eine klare Grenze, die man nicht überschreiten darf. Indigene Figuren müssen von indigenen Schauspieler*innen gespielt werden. Wir haben hier jedoch das Problem, dass es Leute gibt, die behaupten, indigen zu sein, es aber nicht sind. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Leute tatsächlich aus den Gemeinschaften kommen, aus denen sie zu kommen behaupten, was zum Glück gar nicht so schwer herauszufinden ist. Wir führen Zählungen über unsere Gemeinschaften durch, wir wissen, wer zu unseren Gemeinschaften gehört. Und selbst wenn jemand vielleicht kein politisches Mitglied ist, aber die genetische Abstammung hat, also blutsverwandt ist, ist das immer noch bekannt.
Ich finde es zwar wichtig, dass indigene Charaktere von indigenen Schauspieler*innen gespielt werden, aber eines der Probleme hier in den Vereinigten Staaten ist, dass wir nicht genügend professionell ausgebildete indigene Schauspieler*innen haben. Es fehlt an Geld und Zugang zu akademischen Institutionen. In Kanada finanziert die Regierung die Produktion von Fernsehserien und Filmen, das macht es einfacher für diejenigen, die weniger Geld in die Ausbildung stecken können.
In den USA haben wir nicht dasselbe System. Deshalb ist jeder Film, der in den USA mit indigenen Schauspieler*innen gedreht wird, eine Möglichkeit, die nächste Generation indigener Künstler*innen in unserer Gemeinschaft auszubilden. Wenn auch nur eine Rolle an einen Nicht-Indigenen verloren geht, bedeutet das, dass wir unser eigenes Talent als Gemeinschaft nicht entwickeln. Viele der Geschichten, die erzählt werden sollen, sind voll von unserem Schmerz, und dass Leute, die nicht zu unseren Gemeinschaften gehören, diese Geschichten erzählen, kommt mir und vielen anderen Menschen wie eine Verletzung vor.
Es ist sehr interessant, dass Sie den sozialen Aspekt mit Blick auf die indigenen Schauspieler*innen betonen. Der wird sonst in der Identitäts-Cancel-Culture-Debatte nie erwähnt. Wie beurteilen Sie denn die alten amerikanischen Westernfilme? Die amerikanischen Indigenen werden ja oft als böse Angreifer aus dem Hinterhalt dargestellt, die netten weißen Siedlern Schaden zufügen. Ich finde das Bild eigentlich noch problematischer als das in den Winnetou-Filmen transportierte, die Filme sind ja eher romantisierend.
Die älteren Western sind zutiefst problematisch. Wir werden fast nie als vollwertige Menschen dargestellt. Sicherlich gab es damals viele Kriege. Aber meist wird nicht thematisiert, wofür die Natives kämpften. Weil es ihre Heimat war, in die die Siedler eindrangen, nun ja, zuerst die US-Armee. Das war unbestelltes Land. Es gab keine Verträge, die besagten, dass dieses oder jenes Land aus Sicht der indigenen Gemeinschaften den Vereinigten Staaten gehörte. Die Darstellung ist flach und binär, zum Beispiel die vom Widerstand der „Wilden“ gegen die „Zivilisation“, wie sie von weißen Bürger*innen der USA repräsentiert wird. In den 1970er-Jahren gab es Versuche, das zu ändern. Aber mir scheint, dass sich erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts ein echter Wandel abzeichnete.
Dennoch: Auch heute noch werden in den USA Western gedreht, in denen der Schwerpunkt, was die Indigenen angeht, auf Gewalt und Tod liegt. Selbst die beste Erzählweise führt dazu, dass der Mythos vom Verschwinden der Natives fortbesteht, denn am Ende des Films sind meistens alle Indigenen tot. Es gibt uns aber noch. Auch wenn die Erzählung komplexer ist und Indigene in die Beratung mit einbezogen werden, bleibt oft diese Botschaft übrig. Also, ich denke, der Western an sich ist „anti-indigen“. Und es ist schwer, dieser Schublade in den Vereinigten Staaten zu entkommen.
Sie sind ein Experte für Bildung an der Miami University in Oxford, Ohio. Was denken Sie darüber, was amerikanischen Schüler*innen heute über die Geschichte Amerikas und den versuchten Genozid beigebracht wird?
Ich selbst war Lehrer an einer öffentlichen Schule und habe an der High School unterrichtet. Also... ich habe es also von innen erlebt. Und ich habe nach wie vor großen Respekt vor Lehrenden an öffentlichen Schulen. Ihnen wird hier in den Vereinigten Staaten eine Menge abverlangt. Leider werden die Schulen als Ort zur Lösung sozialer Probleme angesehen, weil wir nicht genug Unterstützung außerhalb der Schulen finanzieren, um die Bedürfnisse der Familien zu erfüllen. Was ich damit sagen will, ist, dass Lehrende in ihren Klassenzimmern auf eine Menge reagieren müssen. Aber in ihrer Ausbildung werden sie nicht genug darauf vorbereitet, über die indigenen Nordamerikaner*innen so zu sprechen, dass ihre Gemeinschaften heute sagen würden: „Ja, das ist gut. Das ist nuanciert, vielschichtig.“ Lehrende unterrichten oft nach inhaltlichen Standards, die der Staat vorschreibt. Leider gibt es nicht genügend Inhalte, die in Zusammenarbeit mit den indigenen Gemeinschaften entwickelt wurden. Es gibt einzelne Lehrende, die sich sehr bemühen. Aber sie sind die Ausnahme, scheint mir.
Sie haben drei Kinder. Wie nehmen Sie den Unterricht konkret bei ihnen jeweils wahr?
Ich besuche tatsächlich, obwohl ich einen Fulltime-Job habe, manchmal die Klassen meiner Kinder, weil ich möchte, dass ihre Klassenkamerad*innen ein Verständnis für die Miami-Gemeinschaft von heute haben. Es gibt einige Bundesstaaten in den USA, die bessere Arbeit leisten als andere, weil sie auf staatlicher Ebene Materialien erstellt haben. Und sie haben Bildungsmandate, die besagen, dass man über indigene Gemeinschaften unterrichten muss. Sie berichten über indigene Gemeinschaften nicht nur als historische Phänomene, im Geschichtsunterricht.
In Bundesstaaten wie Wisconsin oder Washington wird vorgeschrieben, dass die Kinder etwas über indigene Gemeinschaften als zeitgenössische politische und kulturelle Einheiten lernen müssen. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, denn wenn Kinder etwas über Deutschland in der Vergangenheit lernen, dann wissen sie, dass Deutschland heute noch existiert. Aber wenn sie etwas über die Miami-Gemeinschaft in der Vergangenheit lernen, wissen sie oft nicht, dass es uns heute noch gibt. Man muss also bei uns Indigenen wirklich von der Gegenwart ausgehend rückwärts unterrichten.
Es gibt hier an der Miami University auch einige Indigene.
An der Universität von Miami ist die Situation anders als landesweit, weil die Professor*innen viel mehr Freiheiten haben, ihre Lehrpläne zu gestalten. Und die Miami-Gemeinschaft auf dem Campus hat eine starke Präsenz. Wir haben 18 Mitarbeiter*innen in unserem Zentrum und einige Studierende aus unserer Gemeinschaft hier. Es wird mehr und mehr anerkannt, dass die Miami-Gemeinschaft eine moderne, lebendige Einheit ist.
Haben Sie das Gefühl, dass es an der Universität ein wachsendes Interesse an der Sprache der Miami gibt?
Was unsere Sprache, das Myaamiaataweenki, angeht, so arbeiten wir seit Ende der 1990er-Jahre daran, die Sprache wiederzubeleben. Das Interesse nimmt zu. Die Zahl der Kinder, die zumindest einen Teil unserer Sprache lernen, vergrößert sich. Wir sind jetzt auch in der Lage, Lehrende auszubilden. Wir brauchen mehr Sprachlehrende, weil es mehr Nachfrage gibt. Sobald wir selber mehr Lehrende hervorbringen, werden wir ein wirklich positives Wachstum in der Gemeinschaft erleben. Ich freue mich sehr darauf.
Wollen auch Menschen die Miami-Sprache lernen, die nicht zur Gemeinschaft gehören?
Ja, es gibt ein Interesse von Leuten, die nicht zur Miami-Gemeinschaft gehören, unsere Sprache zu lernen. Im Moment haben wir leider keine Möglichkeit, auf dieses Interesse einzugehen, weil wir bereits zu viel Nachfrage in unserer eigenen Gemeinschaft haben. Einen unserer Lehrer abzugeben, um Nicht-Indigene zu unterrichten, ist also etwas, was wir im Moment nicht tun können. Aber es ist etwas, das wir gerne tun würden. Wir haben kein Problem damit, dass Leute unsere Sprache lernen. Wir versuchen nicht, die Leute vom Lernen abzuhalten. Wir haben deshalb ein Online-Wörterbuch. Und hin und wieder werden wir von Leuten kontaktiert, die nur durch unser Online-Wörterbuch genug von der Sprache gelernt haben, um mit uns sprechen zu können. Da denke ich dann: „Wow, das ist cool. Ich kenne diese Person nicht, aber sie spricht meine Sprache.“
Ich habe in Ihrem Blog gelesen, dass ihre Gemeinschaft ein Wort für „Limonade“ gesucht hat. Mich interessiert, wie oft so etwas passiert? Und was sind die Kriterien für die Auswahl eines Neologismus?
Das ist eine schöne Frage. Wir denken gegenwartsbezogen, die Erneuerung und Aktualisierung unserer Sprache ist uns wichtig. Ich schätze, dass wir jeden bis jeden zweiten Monat ein neues Wort erfinden oder ein altes Wort für unsere heutigen Bedürfnisse umfunktionieren. Denn unsere Sprache ist ja im frühen 20. Jahrhundert eingeschlafen. Für alles, was danach im 20. Jahrhundert alles an Technologie entwickelt wurde, haben wir keine Namen. Deshalb müssen wir ständig neue Wörter erfinden, die unsere Vorfahren aufgrund der Unterdrückung der Sprache in der Zeit, in der all diese neuen Dinge entstanden sind, nicht entwickeln konnten. Normalerweise bin ich an diesem Prozess nicht beteiligt. Ich bin eher auf der Seite der Lehrenden, aber ich beobachte die E-Mail-Threads, in denen das Sprachteam Ideen austauscht. Am Ende wird ein neues Wort in unser Online-Wörterbuch aufgenommen.
Und was für ein Begriff wurde für „Limonade“ gefunden?
Unser Sprachteam nahm oonsaawimini für Zitrone (wörtlich: gelbe Beere) und fügte eine Endung hinzu, die „trinken“ oder „Saft“ bedeutet, um das Wort oonsaawiminaapowi = Limonade zu bilden.
Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Gibt es etwas, was Sie Ihrerseits noch anfügen möchten?
Was mir noch einfällt, ist, dass ich selbst deutsche Wurzeln habe. Meine Großmutter mütterlicherseits wurde in Deutschland geboren und sprach Deutsch. Und mein Ur-Ur-Großvater war Bayer. Es gibt also durchaus familiäre Bindungen nach Deutschland.