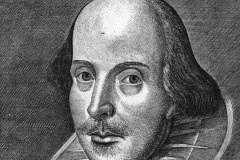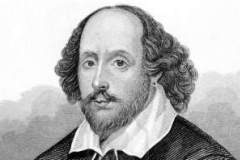Logen-Blog [87]: Der wahre Shakespeare
Nein, dieser maskierte Clown, den Martin Droeshout für die Nachlassedition der Complete Works konterfeite, hat die Werke Shake-speares nicht geschrieben – auch nicht der romantisch dreinblickende Herr, der zu Jean Pauls Zeiten, um 1800 nach dem Chandos-Porträt (das gleichfalls nicht den Verfasser der Stücke, sondern einen verwegenen Piraten zeigt) verewigt wurde.
Das ist hart: „Zur übermäßigen Bewunderung Shakespeares fehlte ihnen nichts als Shakespeare selber. Eben deswegen konnten diese Völker, wie das Kind, von der natürlichen Einfachheit zum gleißenden, lackierten Witzeln heruntergehen.“
Kleiner Exkurs über den wahren Shakespeare
Es ist zwar nicht wichtig, ob Jean Paul den richtigen Verfasser der Dramen „Shakespeares“ kannte, also Edward de Vere, den 17. Earl of Oxford, der inzwischen mit besten Argumenten als wahrer Shakespeare entdeckt wurde – doch gewiss hätte er seine satirischen Anmerkungen dazu gemacht. Für uns ist es relevanter – denn wer den Autor und seine Biographie kennt, liest auch die Stücke etwas anders als vorher: sicher richtiger.
Grundlegende Informationen finden sich auf dieser Seite:
![]() http://shake-speare-today.de/index.90.0.1.html
http://shake-speare-today.de/index.90.0.1.html
Wenn der kleine Shakespearologe das alles gelesen hat - es kostet natürlich Zeit, macht aber ungeheuren Spaß, denn der Leser lernt in Kürze sehr viel über die Shakespeare-Zeit und wird vor jenen Irrtümern bewahrt, die seltsamerweise immer noch verbreitet werden - dann weiß man genau, dass es nicht um eine „Verschwörung“ ging und geht. Man muss „nur“ die Historie studieren - diese aber sehr genau.
Es gibt auch die bekannten guten Bücher zum Thema:
Walter Klier: Der Fall Shakespeare - Die Autorschaftsdebatte und der 17. Graf von Oxford als der wahre Shakespeare. Sehr kurzweilig, aber seriös.
Joseph Sobran: Genannt: Shakespeare. Leicht lesbar, leider vergriffen.
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Das dicke Buch wirkt auf den ersten Blick etwas schwergängig, enthält aber unglaublich viele Fakten zum Leben Edward de Veres; je länger man liest, desto spannender wird es.
Und es gibt die vielen, äußerst materialreichen Bände des Neuen Shake-Speare-Journals, in denen man 1001 Details und Detailforschungen findet, die die Identität „Shake-speares“ minutiös belegen.
Wer sich in Kürze informieren will, kann zu „Stratfords Fragestunde". 60 Erwiderungen greifen. Auf dieser Seite findet man die komplette Digitalversion des Buchs:
![]() http://shake-speare-today.de/index.212.0.1.html
http://shake-speare-today.de/index.212.0.1.html
Wer dann noch Lust hat, sollte zu Robert Detobels (das ist der deutschsprachige, unglaublich kundige Shake-speare-Forscher, der nur dann polemisiert, wenn er harte Fakten vorweisen kann) Will – Wunsch und Wirklichkeit greifen – und er sollte den Wikipedia-Artikel über den Earl mit Vorsicht genießen, dessen offensichtliche Uninformiertheit in Sachen „Urheberschaftsdebatte“ unausrottbar scheinen[1] (aber nach der Lektüre der Bücher und Artikel wird er darüber lächeln – oder sich darüber ärgern).
-----
[1] „Ein Haupteinwand gegen die Autorschaft Oxfords ist, dass er bereits 1604 starb, wobei elf Dramen Shakespeares nach bisheriger allgemeiner Auffassung später entstanden sind“ - man weiss es inzwischen wirklich besser (wenn man denn wissen will).
Logen-Blog [87]: Der wahre Shakespeare
Nein, dieser maskierte Clown, den Martin Droeshout für die Nachlassedition der Complete Works konterfeite, hat die Werke Shake-speares nicht geschrieben – auch nicht der romantisch dreinblickende Herr, der zu Jean Pauls Zeiten, um 1800 nach dem Chandos-Porträt (das gleichfalls nicht den Verfasser der Stücke, sondern einen verwegenen Piraten zeigt) verewigt wurde.
Das ist hart: „Zur übermäßigen Bewunderung Shakespeares fehlte ihnen nichts als Shakespeare selber. Eben deswegen konnten diese Völker, wie das Kind, von der natürlichen Einfachheit zum gleißenden, lackierten Witzeln heruntergehen.“
Kleiner Exkurs über den wahren Shakespeare
Es ist zwar nicht wichtig, ob Jean Paul den richtigen Verfasser der Dramen „Shakespeares“ kannte, also Edward de Vere, den 17. Earl of Oxford, der inzwischen mit besten Argumenten als wahrer Shakespeare entdeckt wurde – doch gewiss hätte er seine satirischen Anmerkungen dazu gemacht. Für uns ist es relevanter – denn wer den Autor und seine Biographie kennt, liest auch die Stücke etwas anders als vorher: sicher richtiger.
Grundlegende Informationen finden sich auf dieser Seite:
![]() http://shake-speare-today.de/index.90.0.1.html
http://shake-speare-today.de/index.90.0.1.html
Wenn der kleine Shakespearologe das alles gelesen hat - es kostet natürlich Zeit, macht aber ungeheuren Spaß, denn der Leser lernt in Kürze sehr viel über die Shakespeare-Zeit und wird vor jenen Irrtümern bewahrt, die seltsamerweise immer noch verbreitet werden - dann weiß man genau, dass es nicht um eine „Verschwörung“ ging und geht. Man muss „nur“ die Historie studieren - diese aber sehr genau.
Es gibt auch die bekannten guten Bücher zum Thema:
Walter Klier: Der Fall Shakespeare - Die Autorschaftsdebatte und der 17. Graf von Oxford als der wahre Shakespeare. Sehr kurzweilig, aber seriös.
Joseph Sobran: Genannt: Shakespeare. Leicht lesbar, leider vergriffen.
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Das dicke Buch wirkt auf den ersten Blick etwas schwergängig, enthält aber unglaublich viele Fakten zum Leben Edward de Veres; je länger man liest, desto spannender wird es.
Und es gibt die vielen, äußerst materialreichen Bände des Neuen Shake-Speare-Journals, in denen man 1001 Details und Detailforschungen findet, die die Identität „Shake-speares“ minutiös belegen.
Wer sich in Kürze informieren will, kann zu „Stratfords Fragestunde". 60 Erwiderungen greifen. Auf dieser Seite findet man die komplette Digitalversion des Buchs:
![]() http://shake-speare-today.de/index.212.0.1.html
http://shake-speare-today.de/index.212.0.1.html
Wer dann noch Lust hat, sollte zu Robert Detobels (das ist der deutschsprachige, unglaublich kundige Shake-speare-Forscher, der nur dann polemisiert, wenn er harte Fakten vorweisen kann) Will – Wunsch und Wirklichkeit greifen – und er sollte den Wikipedia-Artikel über den Earl mit Vorsicht genießen, dessen offensichtliche Uninformiertheit in Sachen „Urheberschaftsdebatte“ unausrottbar scheinen[1] (aber nach der Lektüre der Bücher und Artikel wird er darüber lächeln – oder sich darüber ärgern).
-----
[1] „Ein Haupteinwand gegen die Autorschaft Oxfords ist, dass er bereits 1604 starb, wobei elf Dramen Shakespeares nach bisheriger allgemeiner Auffassung später entstanden sind“ - man weiss es inzwischen wirklich besser (wenn man denn wissen will).