Logen-Blog [372]: Je früher der Berg dasteht, desto besser.
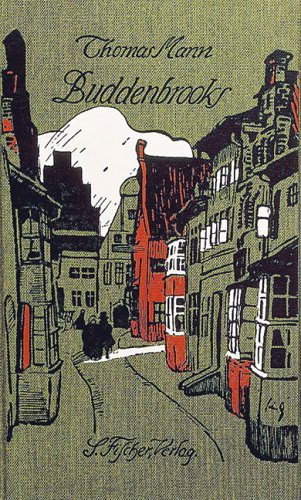
Hat Thomas Mann sich jemals über Jean Paul geäußert? Ich wüsste es nicht – aber die zeitgenössische Kritik hat tatsächlich seinen Romanerstling mit dem Dichter in Zusammenhang gebracht. Ein Karl Hartmann stellte im November 1902 im Literat fest, „dass wir es mit dem Meisterwerk eines großen Dichters, bei dem Jean Paul und stellenweise E.T.A. Hoffmann Gevatter gestanden haben“, zu tun hätten. So liberal waren nicht alle Rezensenten des genialen Wurfs der Buddenbrooks: Hermann Anders Krüger, von Beruf angeblich Literaturwissenschaftler, schrieb, dass der jüngere Bruder Heinrich Manns bloß „eines der langweiligsten Bücher zustande gebracht“ habe – wogegen Samuel Lublinski schlicht und einfach meinte: Buddenbrooks sei ein „unzerstörbares Buch“.
Ita est!
Was aber hat Thomas Mann mit Jean Paul zu tun? Gewiss die Länge des Romans – aber das ist äußerlich. Die Erstausgabe hatte 1100 Druckseiten, auch Titan, Hesperus und Siebenkäs sind bekanntlich umfangreiche Erzählwerke, es sagt nicht viel. Es ist wohl eher der Reichtum der Personen, die detailsüchtige Zeichnung der Ex- und Interieurs, die liebevolle Versenkung des Autors in seine Geschichte, die Karl Hartmann an Jean Paul denken ließ. Ansonsten haben Buddenbrooks und Jean Pauls Romangebirge wenig miteinander gemein: im Vergleich zu den älteren Romanen weist Buddenbrooks eine geradezu klassizistische Klarheit auf – und eben dies ist der Grund, warum der Erstling, im Gegensatz zu allen anderen Romanen Thomas Manns, geradezu volkstümlich wurde. Es ist kein Zufall, dass Buddenbrooks schon früh – nämlich in der Stummfilmzeit – „verfilmt“ werden konnte und Der Zauberberg und Doktor Faustus noch bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf ihre Leinwandexistenz warten mussten: was den Kritiker nicht wundert, denn beide Filme sind, misst man sie an der literarischen „Vorlage“, misslungen.
Ja, ich weiß! Ich weiß das, was schon Thomas Mann wusste: ein Film ist kein Buch und ein Buch ist kein Film. Trotzdem dürfte es sehr schwer fallen, angesichts der „werktreuen“ Filme nicht an das jeweilige Buch zu denken. Der Fehler liegt im System: weil die Drehbuchautoren sich so stark an die Romane hielten. Eben dies zeichnet auch die zehnstündige, allerdings edel besetzte (Martin Benrath, Carl Raddatz, Ruth Leuwerik, Rolf Boysen, Gerd Böckmann …) Verfilmung der Buddenbrooks als Fernsehserie der späten 1970er Jahre aus: ein durchaus honoriges Unternehmen, dass – rein filmästhetisch betrachtet – stellenweise an der fatalen Nähe zu den Dialogen des Romans scheitert – denn ein Thomas-Mann-Satz ist per se noch kein Filmdialogsatz. Den Hinweis auf die zeitgenössische Jean-Paul-Notiz Karl Hartmanns fand ich übrigens im Büchelchen zur jüngst erworbenen Buddenbrooks-Edition, die nicht allein den gründlichen Zehnteiler, auch die zweiteilige Schwarzweiß-Verfilmung der späten 1950er Jahre enthält: eine durchaus amüsante, weil alle philosophischen Aspekte des Romans vernachlässigende Filmfassung des Romans, die gleichfalls durch eine stellenweise ideale Besetzung besticht. Lilo Pulvers Tony ist einfach charmant, Werner Hinzens Konsul von souveräner Würde, Lil Dagovers Konsulin könnte konsulesker kaum sein, Walter Sedlmayr ist als Permaneder schier urmünchnerisch, Robert Graf ein exzellenter Bendix Grünlich, Gustav Knuth ein ausgesprochen norddeutscher Schwarzkopf, Günther Lüders die Karikatur eines extrem plebejischen Corle Smolt, Joseph Offenbach ein ausgesprochen scharf gezeichneter Bankier Kesselmeyer – und Hanns Lothars neurasthenischer Christian Buddenbrook ist das Ereignis dieses Films.
Buddenbrooks: dieser Roman verbürgt – trotz dem genialisch ausgefieselten Epochengemälde des monumentalen Zauberberg, trotz der musikhistorischen tour de force des Doktor Faustus, trotz der orientalischen Erzählungsmanie des Josephsromans (und einer unvergesslichen, bewegenden Szene: der Geburt Josephs), trotz der stellenweise zauberhaften Königlichen Hoheit [1] und des Witzes wie der Witze des Felix Krull – einzig das unverfälschte Genie seines Autors, der mit seinem Erstling die Gattung des Bildungsromans, die im 19. Jahrhundert schon gescheitert war, auf eine radikale Spitze trieb. Hatte Jean Paul es schon mit dem Titan kaum vermocht, die gesellschaftlichen Widersprüche, die er seinem fürstlichen Helden Albano auflastete, in einem dramaturgisch überzeugenden Finale zu lösen, so ließ Thomas Mann seine Helden Thomas und Hanno Buddenbrook im schopenhauerisch inspirierten Elend enden. War das jeanpaulisch?
In gewisser Weise – ja, denn auch Untergänge und Abstürze gehören ja zum Rüstzeug aufgeklärter jeanpaulscher Weltenschiffer. Davon weiß nicht nur Giannozzo, davon weiß auch der Kapitän Ottomar. Und mal sehen, was noch mit dem traurigen Gustav passiert, der mir so übersensibel und antibürgerlich erscheint wie der kleine Hanno Buddenbrook – aber es war gewiss nicht diese Nähe der Mannschen Helden zu Jean Pauls depressiven Gestalten, die den Kritiker von 1902 an den Bayreuther Romancier erinnerte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Hartmann einen Satz aus der Vorschule der Ästhetik im Erinnerungsspeicher hatte, als er Buddenbrooks rezensierte – einen dichtungstheoretischen Satz, den auch der Autor der Buddenbrooks beherzigt hatte:
Je früher der Berg dasteht, der einmal die Wetterscheide einer Verwicklung werden soll, desto besser.
Jean Paul meinte auch, dass schon am Anfang einer Erzählung deren Grundmotive anklingen sollten – der Anfang der Buddenbrooks beherzigt diese Lehre nicht, indem sie direkt aufs böse Ende verweist, sondern indem die kleine Tony Buddenbrook gemäß dem Katechismus alles das aufzählt, was am Ende der Geschichte nicht mehr zu ihren Besitztümern gehören wird: Haus und Hof, Weib und Kind, Acker und Vieh.[2]
Man kann den Zusammenhang zwischen Jean Paul und Thomas Mann natürlich auch statistisch betrachten und mit Renate Just zum Ergebnis kommen, das zu Jean Pauls 250. Geburtstag in der Zeit publiziert wurde:
Schreibwütig bis ans Grab, schuf er ein gewaltigeres Gesamtwerk als das von Goethe und Thomas Mann zusammengenommen.
Mag ja sein, dass Jean Paul mehr an literarischen Worten auswarf als Goethe und Thomas Mann zusammen. Es sagt nicht viel, ja: es sagt bei genauerer Betrachtung nichts; die Gründe dürften jedem Literaturfreund einleuchten. Ich bin auch nicht sicher, ob man die Tausenden von Aphorismen und Notizen, die sich in Jean Pauls Nachlass fanden und nur ausnahmsweise ins Gesamtwerk wanderten, zu eben diesem Gesamtwerk zählen soll. Ergo: der Vergleich mit dem vielbändigen Gesamtwerk des Romanciers und Essayisten Thomas Mann und mit dem Œuvre des Lyrikers, Dramatikers, Romanschreibers und äußerst fleißigen Schriftenverfertigers Goethe scheint mir an den Haaren herbeigezogen zu sein – im besten Fall ein Artefakt des „feuilletonistischen Zeitalters“, das Manns Kollege Hermann Hesse schon sinnlos fand.
Was bleibt, sind nicht die Feuilletons, sondern die Werke – wie der einzige Roman über den „Verfall einer Familie“.
So sieht ein jugendliches Literaturgenie aus: Thomas Mann um 1900 (Wikimedia: Foto H.-P.Haack)
---------------------------------------------------
[1] Was eher an der (tatsächlich:) unvergleichlichen Mischung aus Damenhaftigkeit und jugendlicher Frische, ja: an der schlicht bezaubernden Präsenz liegt, die Ruth Leuwerik – die Darstellerin der Imma Spoelmann – der Rolle schenkte.
[2] Hat der Blogger diesen subtilen Zusammenhang im Wintersemester 1985/86 begriffen, als er daran ging, beim verehrten Professor Alfred Behrmann Buddenbrooks zu lesen und fürs Seminar zu interpretieren? Zwar benutzte er fleißig die Sekundärliteratur, aber ob er auch innerlich verstand, wie subtil Thomas Mann hier vorging – das weiß er nicht mehr (er vermutet heute: eher nicht).
Logen-Blog [372]: Je früher der Berg dasteht, desto besser.
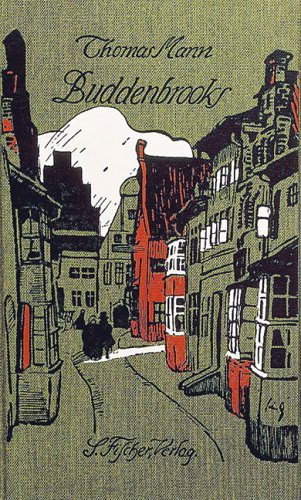
Hat Thomas Mann sich jemals über Jean Paul geäußert? Ich wüsste es nicht – aber die zeitgenössische Kritik hat tatsächlich seinen Romanerstling mit dem Dichter in Zusammenhang gebracht. Ein Karl Hartmann stellte im November 1902 im Literat fest, „dass wir es mit dem Meisterwerk eines großen Dichters, bei dem Jean Paul und stellenweise E.T.A. Hoffmann Gevatter gestanden haben“, zu tun hätten. So liberal waren nicht alle Rezensenten des genialen Wurfs der Buddenbrooks: Hermann Anders Krüger, von Beruf angeblich Literaturwissenschaftler, schrieb, dass der jüngere Bruder Heinrich Manns bloß „eines der langweiligsten Bücher zustande gebracht“ habe – wogegen Samuel Lublinski schlicht und einfach meinte: Buddenbrooks sei ein „unzerstörbares Buch“.
Ita est!
Was aber hat Thomas Mann mit Jean Paul zu tun? Gewiss die Länge des Romans – aber das ist äußerlich. Die Erstausgabe hatte 1100 Druckseiten, auch Titan, Hesperus und Siebenkäs sind bekanntlich umfangreiche Erzählwerke, es sagt nicht viel. Es ist wohl eher der Reichtum der Personen, die detailsüchtige Zeichnung der Ex- und Interieurs, die liebevolle Versenkung des Autors in seine Geschichte, die Karl Hartmann an Jean Paul denken ließ. Ansonsten haben Buddenbrooks und Jean Pauls Romangebirge wenig miteinander gemein: im Vergleich zu den älteren Romanen weist Buddenbrooks eine geradezu klassizistische Klarheit auf – und eben dies ist der Grund, warum der Erstling, im Gegensatz zu allen anderen Romanen Thomas Manns, geradezu volkstümlich wurde. Es ist kein Zufall, dass Buddenbrooks schon früh – nämlich in der Stummfilmzeit – „verfilmt“ werden konnte und Der Zauberberg und Doktor Faustus noch bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf ihre Leinwandexistenz warten mussten: was den Kritiker nicht wundert, denn beide Filme sind, misst man sie an der literarischen „Vorlage“, misslungen.
Ja, ich weiß! Ich weiß das, was schon Thomas Mann wusste: ein Film ist kein Buch und ein Buch ist kein Film. Trotzdem dürfte es sehr schwer fallen, angesichts der „werktreuen“ Filme nicht an das jeweilige Buch zu denken. Der Fehler liegt im System: weil die Drehbuchautoren sich so stark an die Romane hielten. Eben dies zeichnet auch die zehnstündige, allerdings edel besetzte (Martin Benrath, Carl Raddatz, Ruth Leuwerik, Rolf Boysen, Gerd Böckmann …) Verfilmung der Buddenbrooks als Fernsehserie der späten 1970er Jahre aus: ein durchaus honoriges Unternehmen, dass – rein filmästhetisch betrachtet – stellenweise an der fatalen Nähe zu den Dialogen des Romans scheitert – denn ein Thomas-Mann-Satz ist per se noch kein Filmdialogsatz. Den Hinweis auf die zeitgenössische Jean-Paul-Notiz Karl Hartmanns fand ich übrigens im Büchelchen zur jüngst erworbenen Buddenbrooks-Edition, die nicht allein den gründlichen Zehnteiler, auch die zweiteilige Schwarzweiß-Verfilmung der späten 1950er Jahre enthält: eine durchaus amüsante, weil alle philosophischen Aspekte des Romans vernachlässigende Filmfassung des Romans, die gleichfalls durch eine stellenweise ideale Besetzung besticht. Lilo Pulvers Tony ist einfach charmant, Werner Hinzens Konsul von souveräner Würde, Lil Dagovers Konsulin könnte konsulesker kaum sein, Walter Sedlmayr ist als Permaneder schier urmünchnerisch, Robert Graf ein exzellenter Bendix Grünlich, Gustav Knuth ein ausgesprochen norddeutscher Schwarzkopf, Günther Lüders die Karikatur eines extrem plebejischen Corle Smolt, Joseph Offenbach ein ausgesprochen scharf gezeichneter Bankier Kesselmeyer – und Hanns Lothars neurasthenischer Christian Buddenbrook ist das Ereignis dieses Films.
Buddenbrooks: dieser Roman verbürgt – trotz dem genialisch ausgefieselten Epochengemälde des monumentalen Zauberberg, trotz der musikhistorischen tour de force des Doktor Faustus, trotz der orientalischen Erzählungsmanie des Josephsromans (und einer unvergesslichen, bewegenden Szene: der Geburt Josephs), trotz der stellenweise zauberhaften Königlichen Hoheit [1] und des Witzes wie der Witze des Felix Krull – einzig das unverfälschte Genie seines Autors, der mit seinem Erstling die Gattung des Bildungsromans, die im 19. Jahrhundert schon gescheitert war, auf eine radikale Spitze trieb. Hatte Jean Paul es schon mit dem Titan kaum vermocht, die gesellschaftlichen Widersprüche, die er seinem fürstlichen Helden Albano auflastete, in einem dramaturgisch überzeugenden Finale zu lösen, so ließ Thomas Mann seine Helden Thomas und Hanno Buddenbrook im schopenhauerisch inspirierten Elend enden. War das jeanpaulisch?
In gewisser Weise – ja, denn auch Untergänge und Abstürze gehören ja zum Rüstzeug aufgeklärter jeanpaulscher Weltenschiffer. Davon weiß nicht nur Giannozzo, davon weiß auch der Kapitän Ottomar. Und mal sehen, was noch mit dem traurigen Gustav passiert, der mir so übersensibel und antibürgerlich erscheint wie der kleine Hanno Buddenbrook – aber es war gewiss nicht diese Nähe der Mannschen Helden zu Jean Pauls depressiven Gestalten, die den Kritiker von 1902 an den Bayreuther Romancier erinnerte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Hartmann einen Satz aus der Vorschule der Ästhetik im Erinnerungsspeicher hatte, als er Buddenbrooks rezensierte – einen dichtungstheoretischen Satz, den auch der Autor der Buddenbrooks beherzigt hatte:
Je früher der Berg dasteht, der einmal die Wetterscheide einer Verwicklung werden soll, desto besser.
Jean Paul meinte auch, dass schon am Anfang einer Erzählung deren Grundmotive anklingen sollten – der Anfang der Buddenbrooks beherzigt diese Lehre nicht, indem sie direkt aufs böse Ende verweist, sondern indem die kleine Tony Buddenbrook gemäß dem Katechismus alles das aufzählt, was am Ende der Geschichte nicht mehr zu ihren Besitztümern gehören wird: Haus und Hof, Weib und Kind, Acker und Vieh.[2]
Man kann den Zusammenhang zwischen Jean Paul und Thomas Mann natürlich auch statistisch betrachten und mit Renate Just zum Ergebnis kommen, das zu Jean Pauls 250. Geburtstag in der Zeit publiziert wurde:
Schreibwütig bis ans Grab, schuf er ein gewaltigeres Gesamtwerk als das von Goethe und Thomas Mann zusammengenommen.
Mag ja sein, dass Jean Paul mehr an literarischen Worten auswarf als Goethe und Thomas Mann zusammen. Es sagt nicht viel, ja: es sagt bei genauerer Betrachtung nichts; die Gründe dürften jedem Literaturfreund einleuchten. Ich bin auch nicht sicher, ob man die Tausenden von Aphorismen und Notizen, die sich in Jean Pauls Nachlass fanden und nur ausnahmsweise ins Gesamtwerk wanderten, zu eben diesem Gesamtwerk zählen soll. Ergo: der Vergleich mit dem vielbändigen Gesamtwerk des Romanciers und Essayisten Thomas Mann und mit dem Œuvre des Lyrikers, Dramatikers, Romanschreibers und äußerst fleißigen Schriftenverfertigers Goethe scheint mir an den Haaren herbeigezogen zu sein – im besten Fall ein Artefakt des „feuilletonistischen Zeitalters“, das Manns Kollege Hermann Hesse schon sinnlos fand.
Was bleibt, sind nicht die Feuilletons, sondern die Werke – wie der einzige Roman über den „Verfall einer Familie“.
So sieht ein jugendliches Literaturgenie aus: Thomas Mann um 1900 (Wikimedia: Foto H.-P.Haack)
---------------------------------------------------
[1] Was eher an der (tatsächlich:) unvergleichlichen Mischung aus Damenhaftigkeit und jugendlicher Frische, ja: an der schlicht bezaubernden Präsenz liegt, die Ruth Leuwerik – die Darstellerin der Imma Spoelmann – der Rolle schenkte.
[2] Hat der Blogger diesen subtilen Zusammenhang im Wintersemester 1985/86 begriffen, als er daran ging, beim verehrten Professor Alfred Behrmann Buddenbrooks zu lesen und fürs Seminar zu interpretieren? Zwar benutzte er fleißig die Sekundärliteratur, aber ob er auch innerlich verstand, wie subtil Thomas Mann hier vorging – das weiß er nicht mehr (er vermutet heute: eher nicht).


