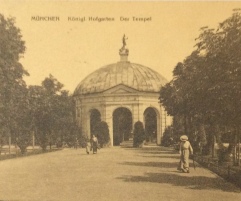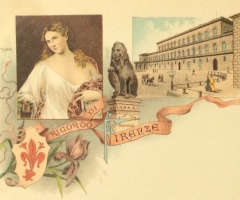München leuchtete

Der erste Absatz der Novelle besteht aus zwei Wörtern, „München leuchtete“, und einem längeren nachfolgenden Text, der hier in voller Länge zitiert wird:
Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide, und ihre breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten, schönen Junitages [4].
Traditionell wird diese Stadtbeschreibung angesichts des vorgehenden Einleitungssatzes als hymnische Darstellung der Stadt München aufgefasst, aber seine bewusst allgemein gehaltene Auflistung der topografischen Elemente lässt auch den Schluss zu, die Beschreibung könne sich stellenweise genauso gut auf die Stadt Florenz beziehen. Mann verschleiert, indem er die beiden Städte gleich von Anfang an subtil verschmilzt und Bauwerke und Monumente von beiden Städten einbezieht. Es gibt „festliche Plätze“ in München und Florenz, wie etwa den Marienplatz und die Piazza della Signoria, „weiße Säulentempel“ gibt es dagegen nur in München, beispielsweise das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz, die Glyptothek, das Monopteros im Englischen Garten oder das Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz (Abb. 1). Unter dem etwas vagen Begriff ‚antikisierende Monumente‘ findet man in München beispielsweise bei Architektur und Monumentalplastik die Propyläen am Königsplatz, den Tempel im Kgl. Hofgarten (Abb. 2) sowie das Reiterstandbild König Ludwigs I. am Odeonsplatz, 1857-1862 von Max von Widnmann (1812-1895) entworfen und ausgeführt, passenderweise von zwei Pagen mit Florentinischem Haarschnitt der Renaissance und mit entsprechendem Habitus gestaltet (Abb. 3).
Abb. 2 und 3
In Florenz sind ebenfalls monumentale Reiterstandbilder aus Bronze zu finden, deren Form auf klassisch-römische Vorbilder zurückgehen, wie etwa das Reiterstandbild des Großherzogs Ferdinando de Medici von Giovanni da Bologna und Pietro Tacca, 1602-07, das 1608 auf der Piazza Santissima Annunziata errichtet wurde. Weitere vergleichbare Monumente in München und Florenz sind die Figur des sitzenden, Wappen haltenden Bronzelöwen vor der Residenz an der Residenzstraße, vor 1596 vom niederländischen Bildhauer Hubert Gerhard (um 1440/50-1520) und dem Florentinischen Bronzegießer Carlo di Cesare del Palagio (1538-1598) erschaffen (Abb. 4), sowie der ‚Marzocco‘, der sitzende Löwe nach Entwurf von Donatello, 1420, der ein Wappen mit der Florentinischen Lilie hält und der sich heute im Bargello in Florenz befindet: Eine Kopie in Sandstein befindet sich neben dem Neptunbrunnen – einem „springenden“ Brunnen – auf der Piazza delle Signoria in Florenz (Abb. 5).
Abb. 4
Abb. 5 und 6
Die von Thomas Mann erwähnten „Barockkirchen“ weisen beide Städte in vielfacher Auswahl aus, „springende Brunnen“ sind in München u.a. auf beiden Seiten des Universitätsareals an der Ludwigstraße, nach Entwurf von Friedrich von Gärtner (1840-1844) (Abb. 6) in Anlehnung an den Doppelschalenbrunnen von Bernini auf dem Petersplatz in Rom: Ebenso wichtig für das Münchener Stadtbild ist der ‚Wittelsbacher Brunnen‘ im „antikisierenden“, italienischen Stil am Lenbachplatz, von dem in Florenz lebenden Bildhauer Adolf von Hildebrand 1892-1895 entworfen, während der ‚Neptunbrunnen‘ in der Piazza della Signoria vor dem Palazzo Vecchio steht, der 1560-1574 von den beiden Florentiner Bildhauern Baccio Bandinelli (Entwurf) und Bartolomeo Ammanati (Ausführung) errichtet wurde (Abb. 7 u. 8).
Abb. 7 und 8
[4] Thomas Mann. Frühe Erzählungen 1893-1912. Hg. von Terence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., Bd. 2.1, 2004.
Weitere Kapitel:

Der erste Absatz der Novelle besteht aus zwei Wörtern, „München leuchtete“, und einem längeren nachfolgenden Text, der hier in voller Länge zitiert wird:
Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide, und ihre breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten, schönen Junitages [4].
Traditionell wird diese Stadtbeschreibung angesichts des vorgehenden Einleitungssatzes als hymnische Darstellung der Stadt München aufgefasst, aber seine bewusst allgemein gehaltene Auflistung der topografischen Elemente lässt auch den Schluss zu, die Beschreibung könne sich stellenweise genauso gut auf die Stadt Florenz beziehen. Mann verschleiert, indem er die beiden Städte gleich von Anfang an subtil verschmilzt und Bauwerke und Monumente von beiden Städten einbezieht. Es gibt „festliche Plätze“ in München und Florenz, wie etwa den Marienplatz und die Piazza della Signoria, „weiße Säulentempel“ gibt es dagegen nur in München, beispielsweise das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz, die Glyptothek, das Monopteros im Englischen Garten oder das Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz (Abb. 1). Unter dem etwas vagen Begriff ‚antikisierende Monumente‘ findet man in München beispielsweise bei Architektur und Monumentalplastik die Propyläen am Königsplatz, den Tempel im Kgl. Hofgarten (Abb. 2) sowie das Reiterstandbild König Ludwigs I. am Odeonsplatz, 1857-1862 von Max von Widnmann (1812-1895) entworfen und ausgeführt, passenderweise von zwei Pagen mit Florentinischem Haarschnitt der Renaissance und mit entsprechendem Habitus gestaltet (Abb. 3).
Abb. 2 und 3
In Florenz sind ebenfalls monumentale Reiterstandbilder aus Bronze zu finden, deren Form auf klassisch-römische Vorbilder zurückgehen, wie etwa das Reiterstandbild des Großherzogs Ferdinando de Medici von Giovanni da Bologna und Pietro Tacca, 1602-07, das 1608 auf der Piazza Santissima Annunziata errichtet wurde. Weitere vergleichbare Monumente in München und Florenz sind die Figur des sitzenden, Wappen haltenden Bronzelöwen vor der Residenz an der Residenzstraße, vor 1596 vom niederländischen Bildhauer Hubert Gerhard (um 1440/50-1520) und dem Florentinischen Bronzegießer Carlo di Cesare del Palagio (1538-1598) erschaffen (Abb. 4), sowie der ‚Marzocco‘, der sitzende Löwe nach Entwurf von Donatello, 1420, der ein Wappen mit der Florentinischen Lilie hält und der sich heute im Bargello in Florenz befindet: Eine Kopie in Sandstein befindet sich neben dem Neptunbrunnen – einem „springenden“ Brunnen – auf der Piazza delle Signoria in Florenz (Abb. 5).
Abb. 4
Abb. 5 und 6
Die von Thomas Mann erwähnten „Barockkirchen“ weisen beide Städte in vielfacher Auswahl aus, „springende Brunnen“ sind in München u.a. auf beiden Seiten des Universitätsareals an der Ludwigstraße, nach Entwurf von Friedrich von Gärtner (1840-1844) (Abb. 6) in Anlehnung an den Doppelschalenbrunnen von Bernini auf dem Petersplatz in Rom: Ebenso wichtig für das Münchener Stadtbild ist der ‚Wittelsbacher Brunnen‘ im „antikisierenden“, italienischen Stil am Lenbachplatz, von dem in Florenz lebenden Bildhauer Adolf von Hildebrand 1892-1895 entworfen, während der ‚Neptunbrunnen‘ in der Piazza della Signoria vor dem Palazzo Vecchio steht, der 1560-1574 von den beiden Florentiner Bildhauern Baccio Bandinelli (Entwurf) und Bartolomeo Ammanati (Ausführung) errichtet wurde (Abb. 7 u. 8).
Abb. 7 und 8
[4] Thomas Mann. Frühe Erzählungen 1893-1912. Hg. von Terence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., Bd. 2.1, 2004.