Des san mia
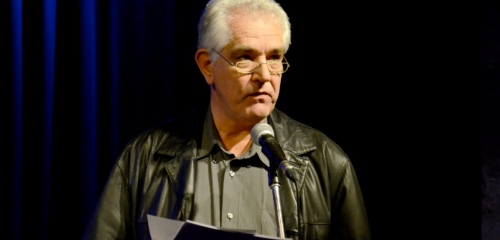
Die Anthologie Vastehst me - Bairische Gedichte aus 40 Jahren von 2014 bietet eine aufschlussreiche Zusammenschau, in der die inhaltlichen und ästhetischen Schwerpunkte deutlich werden, die Mundartlyriker aus dem bairischen Sprachraum setzen, vom Oberpfälzischen über das Niederbairische zum Münchnerischen. Die Herausgeber nennen es die „süddeutsche Hochsprache“. Darin liegt nicht nur eine Beschreibung, sondern auch ein Anspruch: Diese Lyrik proklamiert Eigenständigkeit und soll neben der hochdeutschen bestehen können, und mir scheint, dass das an vielen Stellen gelingt. Das gilt auch für viele ältere Gedichte, gesammelt in Friedl Brehms Anthologie Sagst wasd magst von 1975.
Beginnen wir mit der Selbstverortung der Autoren. Es gibt ein programmatisches Gedicht von Bernhard Setzwein, in dem er erklärt, wie man mit Lyrik am besten umgeht, nämlich pragmatisch. Es heißt: „Gedichte muaßd trocknan wiad Schwammerl“ (Bauernfeind et al., S. 184).
...
A jedz muaßd onzln da oschaugn
obs ned scho inwenidig wurmstiche
oda dafeid is
muaßdz sauwa putzn aufschnein und herlegn
Nacha laßdas liegn lang liegn
bises zsammziagd zu am Huuzl
Awa do is nacha a Gschmacke drin
mei Liawa
...
Setzwein folgt gedanklich Bertolt Brecht, der in seinem Text „Über das Zerpflücken von Gedichten“ schrieb, „dass nicht einmal Blumen verwelken, wenn man in sie hineinsticht ... Wer das Gedicht für unnahbar hält, kommt ihm wirklich nicht nahe. In der Anwendung von Kriterien liegt ein Hauptteil des Genusses. Zerpflücke eine Rose und jedes Blatt ist schön.“
Brecht und Setzwein plädieren für einen unverkrampften Umgang mit Lyrik, doch wo Brecht noch zarte Rosen anführt, sind es bei Setzwein Schwammerl: nicht auf Humus gezüchtet, sondern auf feuchtem Waldboden gewachsen, nicht lieblich, sondern mal gschmackig, mal fad und manchmal giftig. Ich mag die handfeste Poetik, mit der der Autor auf Gedichte schaut wie auf Gebrauchsgegenstände: Taugen sie was, und wenn ja, wozu? Das Alles-als-Kunst-gelten-lassen lässt Setzwein jedenfalls nicht gelten.
Mir scheint, dass viele Mundartautoren ihren Brecht gut kennen. Zum Beispiel Elisabeth Dorner-Wenzliks „Grenzwertexpertn“ (ebd., S. 39):
ja, herrschaftsseitn,
mir habn s doch berechnet,
daß des giftige Zeug dao,
verteilt in da Luft,
von dera Zal abwärts,
ix ausmache derfat,
ja, herrschaftsseitn,
äitz wird ma doch
erwartn derfa,
daß sie aa a weng mitspielt,
d Natur!
Die Idee folgt Brechts Gedicht „Die Lösung“, geschrieben nach dem Arbeiteraufstand in der DDR, in dem gefragt wird: „… Wäre es da / Nicht doch einfacher, die Regierung / Löste das Volk auf und / Wählte ein anderes?“
Insgesamt überrascht mich die Fülle an Bezugnahmen auf große Vorbilder. Eugen Oker etwa schreibt in „an Goethe“ (ebd., S. 161):
iwa de bam iss scho schdaad
koi liffdal waad
drinnad en wold b feechala schlouffa
fo driwahal hea
lus nea
dou woadd aaf di wea
heasd wäis de rouffa
Derber noch macht sich Franz Ringseis seinen Reim in „Wanderers Nachtlied“ (Brehm, S. 120):
Üba olle Gipfen
iss stad.
In olle Wipfen
waht
nur a Lüftal, so weich –
Koa Vogal rührt si im Woid.
Wart nur, boid
bist aar a Leich.
Im Vergleich dazu Goethes Vorbild:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Das Beispiel zeigt, in welcher Reihe sich die Mundartlyriker sehen. Zurecht, denn auch der Hesse Goethe war ja ein großer Mundartdichter, anders lassen sich manche Reime etwa im Urfaust nicht erklären: „Ach, neige, neige / Du Strahlenreiche ...“. Schön, wie selbstverständlich und vor allem wie eigenständig sich die Bayern daneben stellen. So wie Alfons Schweiggert. Ihm ist „am grob vom karl valentin“ keineswegs schenkelklopferisch, vielmehr expressionistisch-existenzialistisch zumute, wenn er Valentins Lebensverzweiflung nachspürt (Bauernfeind et al., S. 153):
es is jetz zeit
für koide händ
a dunkla liachtfleck
zittat am eisngitter
vom grobstoa
abbröcklt d’angst
a fetzn sonn loahnt si
ans ausbrennende grobliacht
unterm kies schnauft d’wuat
von da bluatbuacha foit
a lächeln, des grod gstorbn is
und
wia i geh,
stelln si mir fragn
in weg
i mach an bogn um sie
in friedhofsbrunna
kichan wassertropfn nei
Weitere Kapitel:
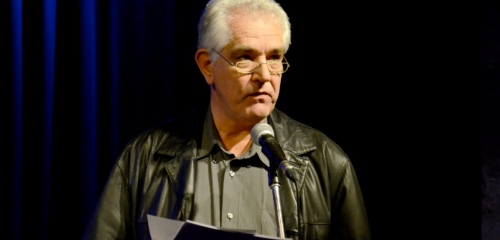
Die Anthologie Vastehst me - Bairische Gedichte aus 40 Jahren von 2014 bietet eine aufschlussreiche Zusammenschau, in der die inhaltlichen und ästhetischen Schwerpunkte deutlich werden, die Mundartlyriker aus dem bairischen Sprachraum setzen, vom Oberpfälzischen über das Niederbairische zum Münchnerischen. Die Herausgeber nennen es die „süddeutsche Hochsprache“. Darin liegt nicht nur eine Beschreibung, sondern auch ein Anspruch: Diese Lyrik proklamiert Eigenständigkeit und soll neben der hochdeutschen bestehen können, und mir scheint, dass das an vielen Stellen gelingt. Das gilt auch für viele ältere Gedichte, gesammelt in Friedl Brehms Anthologie Sagst wasd magst von 1975.
Beginnen wir mit der Selbstverortung der Autoren. Es gibt ein programmatisches Gedicht von Bernhard Setzwein, in dem er erklärt, wie man mit Lyrik am besten umgeht, nämlich pragmatisch. Es heißt: „Gedichte muaßd trocknan wiad Schwammerl“ (Bauernfeind et al., S. 184).
...
A jedz muaßd onzln da oschaugn
obs ned scho inwenidig wurmstiche
oda dafeid is
muaßdz sauwa putzn aufschnein und herlegn
Nacha laßdas liegn lang liegn
bises zsammziagd zu am Huuzl
Awa do is nacha a Gschmacke drin
mei Liawa
...
Setzwein folgt gedanklich Bertolt Brecht, der in seinem Text „Über das Zerpflücken von Gedichten“ schrieb, „dass nicht einmal Blumen verwelken, wenn man in sie hineinsticht ... Wer das Gedicht für unnahbar hält, kommt ihm wirklich nicht nahe. In der Anwendung von Kriterien liegt ein Hauptteil des Genusses. Zerpflücke eine Rose und jedes Blatt ist schön.“
Brecht und Setzwein plädieren für einen unverkrampften Umgang mit Lyrik, doch wo Brecht noch zarte Rosen anführt, sind es bei Setzwein Schwammerl: nicht auf Humus gezüchtet, sondern auf feuchtem Waldboden gewachsen, nicht lieblich, sondern mal gschmackig, mal fad und manchmal giftig. Ich mag die handfeste Poetik, mit der der Autor auf Gedichte schaut wie auf Gebrauchsgegenstände: Taugen sie was, und wenn ja, wozu? Das Alles-als-Kunst-gelten-lassen lässt Setzwein jedenfalls nicht gelten.
Mir scheint, dass viele Mundartautoren ihren Brecht gut kennen. Zum Beispiel Elisabeth Dorner-Wenzliks „Grenzwertexpertn“ (ebd., S. 39):
ja, herrschaftsseitn,
mir habn s doch berechnet,
daß des giftige Zeug dao,
verteilt in da Luft,
von dera Zal abwärts,
ix ausmache derfat,
ja, herrschaftsseitn,
äitz wird ma doch
erwartn derfa,
daß sie aa a weng mitspielt,
d Natur!
Die Idee folgt Brechts Gedicht „Die Lösung“, geschrieben nach dem Arbeiteraufstand in der DDR, in dem gefragt wird: „… Wäre es da / Nicht doch einfacher, die Regierung / Löste das Volk auf und / Wählte ein anderes?“
Insgesamt überrascht mich die Fülle an Bezugnahmen auf große Vorbilder. Eugen Oker etwa schreibt in „an Goethe“ (ebd., S. 161):
iwa de bam iss scho schdaad
koi liffdal waad
drinnad en wold b feechala schlouffa
fo driwahal hea
lus nea
dou woadd aaf di wea
heasd wäis de rouffa
Derber noch macht sich Franz Ringseis seinen Reim in „Wanderers Nachtlied“ (Brehm, S. 120):
Üba olle Gipfen
iss stad.
In olle Wipfen
waht
nur a Lüftal, so weich –
Koa Vogal rührt si im Woid.
Wart nur, boid
bist aar a Leich.
Im Vergleich dazu Goethes Vorbild:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Das Beispiel zeigt, in welcher Reihe sich die Mundartlyriker sehen. Zurecht, denn auch der Hesse Goethe war ja ein großer Mundartdichter, anders lassen sich manche Reime etwa im Urfaust nicht erklären: „Ach, neige, neige / Du Strahlenreiche ...“. Schön, wie selbstverständlich und vor allem wie eigenständig sich die Bayern daneben stellen. So wie Alfons Schweiggert. Ihm ist „am grob vom karl valentin“ keineswegs schenkelklopferisch, vielmehr expressionistisch-existenzialistisch zumute, wenn er Valentins Lebensverzweiflung nachspürt (Bauernfeind et al., S. 153):
es is jetz zeit
für koide händ
a dunkla liachtfleck
zittat am eisngitter
vom grobstoa
abbröcklt d’angst
a fetzn sonn loahnt si
ans ausbrennende grobliacht
unterm kies schnauft d’wuat
von da bluatbuacha foit
a lächeln, des grod gstorbn is
und
wia i geh,
stelln si mir fragn
in weg
i mach an bogn um sie
in friedhofsbrunna
kichan wassertropfn nei
