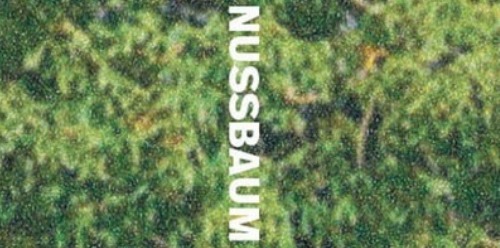Ein Auszug aus dem starken neuen Roman von Katja Huber
Katja Huber wurde 1971 in Weilheim geboren und lebt heute mit ihrer Familie in München. Sie hat Slawische Philologie und Politische Wissenschaften studiert. Seit 1996 arbeitet Katja Huber als Prosa- und Hörfunkautorin, u.a. für den Bayerischen Rundfunk, und ist Trägerin des Bayerischen Staatsförderpreises für Literatur. Auch gesellschaftspolitisch engagiert sie sich. So gehört sie zu den Gründungsmitgliedern von Meet your neighbours, einer Gruppe Münchner Kulturschaffender, die Veranstaltungen mit geflüchteten Künstlern organisiert.
Unterm Nussbaum ist Katja Hubers fünfter Roman. Sie verschränkt darin die Sprache historischer Familienromane mit modernen Erzähltechniken. Sie zeichnet die Abgründe des Verschweigens in der Historie der Familie Berger nach und wie diese beginnt, sich vor der Sprengkraft ihrer Vergangenheit zu fürchten. Dabei bleibt der Text ernst, ohne je pathetisch zu sein, humorvoll, ohne ins Banale abzugleiten, er trifft das Zeitkolorit der verschiedenen Epochen und zeigt die Anstrengungen der Gegenwart, ihrem eigenen Rätsel auszuweichen. (Verlagstext)
*
Barbara Berger geht auf ihren 70. Geburtstag zu. Ihre vier Kinder leben an verschiedenen Orten in Deutschland und Frankreich, der Kontakt untereinander ist verhalten. Bis Miriam, die Älteste, beschließt, den Geburtstag ihrer Mutter in jenem Haus am Ammersee zu feiern, in dem Barbara Berger aufgewachsen ist. Von überall her ruft sie die Familie zusammen, lässt jedoch ihre Mutter über den Ort der Festlichkeit im Unklaren. Sie ahnt nicht, dass für Barbara so viele Erinnerungen an diesem Dorf hängen, dass sie niemals dorthin zurückkehren wollte. Miriam bucht für ihre Mutter einen Flug nach München, den diese nicht antreten wird, während ihre Familie sich in der vermeintlichen Idylle bereits auf das große Fest vorbereitet ...
Die Erzählung aber beginnt früher, in den Dreißigerjahren, als die aufkeimende Liebe zweier junger Frauen mit der Machtübernahme Hitlers eine dramatische Wende erfährt. Nur ist Barbaras Kindern diese Vergangenheit ihrer Familie noch verschlossener als das Rätsel um ihre verschiedenen Väter. Erst ein merkwürdig erscheinender Nachbar und sein Sohn bringen Licht in dieses Dunkel, das ein Schicksal von blendender Intensität birgt.
Wir publizieren den Anfang des Romans.
**
1930: Anna
(Anna, 15)
Ach, Judith, wenn der Himmel, genau dieser Himmel, doch immer unser Zudeck sein könnte; und dieses Licht unser täglicher Morgengruß, dachte Anna.
Du,
Hut,
Jud,
schrieb sie dann. Sie saß im Gras, spürte Judiths Wade an ihrer, nutzte die Oberschenkel als Unterlage und schützte die halbe Leerseite, die sie übermütig aus ihrem Lieblingsbuch gerissen hatte und die ihr nun als Zettel diente, mit dem Handrücken vor den Blicken der Freundin.
An,
na,
schrieb Judith, dann skizzierte sie mit wenigen Strichen eine Blume.
Ansehen.
Nicken.
Zettel tauschen.
Lesen.
Grinsen.
»Ein Wort mehr, ich habe gewonnen.«
»Natürlich, dein Name gibt noch weniger Worte her als meiner. Dafür lese ich dich viel lieber rückwärts als mich, du, du schlichtes Mädchen im Alltagskleid.«
Anna nahm zwei Äpfel aus ihrem Korb, eine weiße Serviette und ein Messer. »Womit fangen wir an?«
»Das …«, ohne zu registrieren, wie Anna mehrmals sanft über die Skizze strich, als fürchtete sie, die Blume zum Welken zu bringen, wies Judith auf deren Zettel, »… war ja erst die Ouvertüre.« Dann ließ sie ihre Fingerkuppen über die sonnenwarme Haut der Freundin tanzen. »Zuerst das Ritual, dann der Apfel. Wir sind ja nicht im Garten Eden. Außerdem muss die Klinge sauber sein, sonst riskieren wir eine Blutvergiftung.« Judith nahm das Messer, blies über die Klinge, wischte sie an der noch blütenweißen Stoffserviette ab und hielt der Freundin die Innenseite ihres Arms entgegen. »Du zuerst!«
Anna schluckte, schüttelte den Kopf, weigerte sich, das Messer anzunehmen, krempelte den rechten Ärmel ihrer Bluse hoch. »Nein, du, erst du!«
Judith zuckte mit den Schultern.
Und wenn eine von uns verblutet? Der Gedanke war lächerlich, aber er ließ Anna nicht los, sie konnte kein Blut sehen, fühlte schon jetzt den Schmerz. Kein Mensch dieser Welt außer Judith dürfte ihr jemals mit dem Messer nahe kommen. Sie spürte den warmen, frischen Atem der Freundin, sah lange, dichte, geschwungene Wimpern, wusste, dass die Augen unter diesen Wimpern nach der bestmöglichen Stelle zum tiefen Schnitt spähten. Werden sie mich jemals kitzeln, diese Wimpern? Am Hals, im Nacken? Sie sah, wie sich Judiths Nasenflügel blähten, der Mund sich leicht öffnete, bevor – ein vorletzter Moment der Konzentration – die Zunge hervorspitzte, wieder verschwand.
Kalt spürte Anna die Klinge am Oberarm, dann einen Stich und ein Brennen, das sich in Sekundenschnelle ausbreitete, und »Aah« entfuhr ihr der Laut, den kein Mensch auf dieser Welt außer Judith ihr jemals würde entlocken können.
Sie schloss die Augen und ließ sich auf die Wiese zurückfallen.
»Aah? Du bist doch von allen guten Geistern verlassen!«, drang Judiths süße Stimme an ihr Ohr. »Ich bin jetzt dran, mach schon!«
Anna öffnete die Augen: Ein roter präziser Schnitt teilte ihren Oberarm in zwei Flächen, die eine weiß, die andere verzierte ein rotes Rinnsal.
»Anna, mach schon!«, drängte Judith und drückte der Freundin das Messer in die Hand.
Doch Anna zitterte nur, in ihrem Mund breitete sich ein Geschmack aus, der dem von Blut nahekam, und in ihren Ohren schwoll ein Rauschen an. Sie griff nach Judiths ausgestrecktem Arm, doch sie hatte nicht einmal die Kraft, das Handgelenk fest zu umschließen.
Judith entriss ihr das Messer, ehe es ihr aus der Hand fallen konnte. Ohne den besorgten Blick von Anna abzuwenden, ritzte sie sich in den Arm, an exakt der gleichen Stelle, ein Schnitt von exakt der gleichen Länge, und schon warf sie das blutige Messer unachtsam ins Moos.
Schon spürte Anna die Kräfte zurückkehren, schon näherten sich die beiden einander, wurde Schnitt auf Schnitt, Wunde auf Wunde, Arm auf Arm gepresst, nicht eine Sekunde, nicht zwei Sekunden, nein drei, vier, fünf schmerzhaft verschworene Sekunden, eine euphorische Ewigkeit.
Schon richtete Judith sich auf, griff erneut zum Messer, nahm die wenigen Schritte über waldiges Moos zur nächsten Birke, die, jung noch, aber rindenreich, nur auf die Begegnung mit den beiden Mädchen gewartet zu haben schien.
Schon ritzte Judith Rinde so rigoros wie zuvor Haut: »Das Häuten habe ich mir für den Baum aufgespart.«
Lachend kehrte sie mit zwei Rindenstreifen zurück und lachend bettete sie ihren Kopf auf den Bauch ihrer Freundin, die ihr ein Rindenpflaster verpasste, ehe Judith sie ebenfalls verarztete. Dann verstummten sie, sahen entlang der schwarz-weiß-grauen Stämme durch hellgrüne Blätter ins Blau des Nachmittages.
Judith vernahm ein Zwitschern in weiter Ferne: »Ein Zeisig!«
Anna vernahm ein Pochen ganz nah. Ein Herz!
Judith verabschiedete sich vom Himmel, ein wenig zu schnell vielleicht für Annas Gefühl, und widmete sich erneut den Schnitten, den Wunden, den Rinden: »Was für ein Irrsinn!«, erzählte sie dem Zeisig. »Ist dir klar, dass wir gerade ein germanisches Ritual vollzogen haben?«
»Wieso germanisch?«, Anna schob den Kopf ihrer Freundin zur Seite, um nach ihrem Lieblingsbuch zu greifen: »Seit wann sind die Mescalero-Apachen germanisch?«
»Das fragst du am besten deinen Karl May.« Judith sprang ohne Vorwarnung in die Hocke, ließ sich auf die liegende Anna fallen und presste ihr, nicht auf die Wunde, sondern auf die Stirn, keine Rinde, sondern einen Kuss. Einen Blutsschwesternkuss?
2013: Vorabend des Festes
(Erwartung)
»Natürlich wollte ich. Aber ich kann den Termin nicht wahrnehmen.«
»Du sollst keinen Termin wahrnehmen, sondern deine Mutter vom Flughafen abholen.«
»Mach mir bitte kein schlechtes Gewissen. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, und die Kinder haben alle einen Führerschein. Drück einem von ihnen einen Autoschlüssel in die Hand, und sie werden sich streiten, wer einen Ausflug zum Flughafen machen darf.«
»Darum geht es doch nicht! Natürlich wird irgendjemand Zeit haben.«
»Nicht irgendjemand; das sind Menschen, die ihr nahestehen. Egal, wer sie abholt, sie wird sich freuen.«
Abholen wird, verbessert Miriam ihren Bruder Michael in Gedanken, oder eben nicht abholen wird. »Sie wird enttäuscht sein. Die Sache mit dem Familientreffen hat sie mir auch nicht wirklich abgekauft. Dass wir das Bedürfnis nach gemeinsamem Urlaub haben! Sie erwartet ihren ältesten Sohn am Flughafen. Und niemand anderen.«
»Dann wird es für sie eben eine vorzeitige Geburtstagsüberraschung geben: Natalie, Ben, Valentina … Paul, wer auch immer.«
»Michael, ich kenne meine Familie.«
»Und die Psyche unserer Mutter kennt auch keiner besser als du.«
»Gut genug zumindest, um zu wissen, auf welche Art von Überraschungen sie verzichten kann. Und dass sie nicht unbedingt flexibler geworden ist im Alter.«
»Sagst du.«
»Sage ich.«
»Dann sehen wir uns morgen Abend am Ammersee, Miriam, mit Mutter und allen anderen. Ich muss hier weitermachen.«
»Es kann doch verdammt noch mal nicht so ein Problem sein, eure Großmutter vom Flughafen abzuholen.«
Miriam ärgert sich, dass sie Freiwillige rekrutieren muss, dass sie es ist, die dieses Gespräch führen muss, hier beim Abendessen unter dem großen Walnussbaum – eigentlich ganz so, wie sie es sich immer ausgemalt hat, eine lange Tafel mit weißer Tischdecke, um sie herum die ganze Großfamilie, endlich dort angekommen, wo ihre Mutter aufgewachsen ist.
»Irgendjemand wird sie schon abholen«, flüstert Werner, ihr Mann, und greift nach ihrer Hand, obwohl er weiß, dass sie beide Hände zum Gestikulieren braucht.
»Jeder, der hier sitzt, hat Urlaub, und es spricht nichts dagegen, einen Bruchteil dieses Urlaubs damit zu verbringen, die Frau, die einen geboren und großgezogen hat, vom Flughafen abzuholen«, verkündet sie nun so laut, dass es auch Paul am anderen Ende der Tafel hören kann.
Ihr Neffe Paul, dessen gesamtes Leben eine Entdeckungsreise zu sein scheint und der schon seit Minuten damit beschäftigt ist, die Abendsonne in seinem Fischmesser einzufangen und damit Lichtflecken auf die Gesichter seiner Cousins und Cousinen zu projizieren.
Natalie neben ihr kichert, doch das nimmt sie ihrer jüngsten Nichte nicht übel: Natalie ist gerade fünfzehn geworden – und seit drei Jahren kann sie nichts als kichern, jammern oder heulen, wie Miriam sich regelmäßig von ihrer Schwester in langen, genervten E-Mails aus Paris berichten lassen muss.
»Mich hat sie nicht geboren«, hört sie Natalie sagen.
Trotzdem weißt auch du nicht, wer dein Vater ist, denkt Miriam. Aus dem Augenwinkel sieht sie den Nachbarn, der sich mit einem großformatigen Buch im Schoß, versteckt hinter seiner Sonnenbrille, jenseits des Gartenzauns im Liegestuhl fläzt.
»Danke für die Vermittlung, wir machen uns morgen bekannt«, nickt und ruft sie ihm zu, dann wendet sie sich wieder an ihre Familie. »Irgendjemand muss sie abholen.«
Den Nachbarn könnte man eigentlich auch einladen …
»Irgendjemand wird morgen seine Mutter, Großmutter oder Schwiegermutter vom Flughafen abholen.«
Doch wieso noch Fremde einladen, wenn schon die eigene Familie größte Probleme bereitet?
»Ich will das geklärt haben, bevor wir anfangen zu essen.«
Miriam entgeht nicht, wie der Nachbar im Schutz von Buch und Brille und im Rhythmus ihrer Forderungen mehrfach nickt, wie Paul mit seiner Schwester Valentina tuschelt.
Valentina, die mit fünfzehn noch mit Puppen gespielt hat – das wurde ihr zumindest kolportiert. Ein argloses Wesen, das mit Miriams Pflichtbewusstsein und Aktionismus nicht das Geringste anfangen kann. Doch das Lächeln, das Valentina ihr jetzt zuwirft, ist kein verständnisloses, auch kein vorwurfsvolles, kein überhebliches und auch kein genervtes. Es ist eher verschwörerisch, und bevor Miriam sich eingestehen kann, wie gut dieses Lächeln tut, zwinkert ihr auch noch Paul zu. So, wie man keinem Menschen zuzwinkert, den man nicht mag.
»Tante Miriam, wie wärʼs, wenn wir zur Abwechslung mal dich ausfragen? Immerhin bist du ihre Lieblingstochter. Dir müsste es Oma doch erzählt haben. Kann es sein, dass … dieses Haus … spricht?«
»Spricht?«, fragt Miriam.
Dann hätte es unserer Familie eine Menge voraus, würde sie gern erwidern, doch es tut zu gut, angelächelt zu werden, im Schein der Abendsonne, unter diesem gigantisch großen Nussbaum, und auch die Neugier in den Augen ihres Neffen, die Vorfreude in den Augen ihrer Nichte tun gut.
»Spricht? Wie kommt ihr denn darauf?«
»Spricht, flüstert, lebt. Irgendeinen Grund muss es doch geben, dass Oma dieses Wahnsinnshaus verkauft hat«, sagt Paul.
»Sie hat das Nachbarhaus verkauft. Dieses Haus hat ihr nie gehört«, antwortet Miriam, was ganz offensichtlich nicht die gefragte Information zum Thema ist.
»Ihr seid ja erst heute angekommen«, wendet sich Valentina nun an die Runde. »Die Einzigen, die hier schon eine Nacht verbracht haben, sind Tante Miriam, Onkel Werner und ich. Und es hat nicht nur geknarzt. Ein leises Klopfen war zu hören, und immer wieder so was wie Seufzen. War es in eurem Zimmer denn ruhig, Tante Miriam?«
»Natürlich nicht.« Jetzt ist es Miriam, die lächelt. Erst Richtung Paul und Valentina, dann ihrem Mann direkt ins Gesicht. »Falls es irgendwelche Geister in diesem Haus geben sollte, sind wir vor ihnen sicher. Zumindest solange Werner hier ist und sie mit seinem Schnarchen vertreibt.«
»Geister!«, ruft Angelika jetzt über die Länge des Tisches und zwinkert ihrem Mann Ben zu.
»Geister sind immun gegen Schnarchen, manche lassen sich sogar nur durch Schnarchen anlocken«, sagt der.
Miriam würde gerne gähnen und nach diesem heißen, drückenden Tag einfach nur die letzten Strahlen der Abendsonne genießen, würde gerne schweigend in den Walnussbaum schauen, die zu engen Sandalen ausziehen und die nackten Zehen in den moosigen Boden unterm Esstisch drücken. Würde. Konjunktiv.
Ein Auszug aus dem starken neuen Roman von Katja Huber
Katja Huber wurde 1971 in Weilheim geboren und lebt heute mit ihrer Familie in München. Sie hat Slawische Philologie und Politische Wissenschaften studiert. Seit 1996 arbeitet Katja Huber als Prosa- und Hörfunkautorin, u.a. für den Bayerischen Rundfunk, und ist Trägerin des Bayerischen Staatsförderpreises für Literatur. Auch gesellschaftspolitisch engagiert sie sich. So gehört sie zu den Gründungsmitgliedern von Meet your neighbours, einer Gruppe Münchner Kulturschaffender, die Veranstaltungen mit geflüchteten Künstlern organisiert.
Unterm Nussbaum ist Katja Hubers fünfter Roman. Sie verschränkt darin die Sprache historischer Familienromane mit modernen Erzähltechniken. Sie zeichnet die Abgründe des Verschweigens in der Historie der Familie Berger nach und wie diese beginnt, sich vor der Sprengkraft ihrer Vergangenheit zu fürchten. Dabei bleibt der Text ernst, ohne je pathetisch zu sein, humorvoll, ohne ins Banale abzugleiten, er trifft das Zeitkolorit der verschiedenen Epochen und zeigt die Anstrengungen der Gegenwart, ihrem eigenen Rätsel auszuweichen. (Verlagstext)
*
Barbara Berger geht auf ihren 70. Geburtstag zu. Ihre vier Kinder leben an verschiedenen Orten in Deutschland und Frankreich, der Kontakt untereinander ist verhalten. Bis Miriam, die Älteste, beschließt, den Geburtstag ihrer Mutter in jenem Haus am Ammersee zu feiern, in dem Barbara Berger aufgewachsen ist. Von überall her ruft sie die Familie zusammen, lässt jedoch ihre Mutter über den Ort der Festlichkeit im Unklaren. Sie ahnt nicht, dass für Barbara so viele Erinnerungen an diesem Dorf hängen, dass sie niemals dorthin zurückkehren wollte. Miriam bucht für ihre Mutter einen Flug nach München, den diese nicht antreten wird, während ihre Familie sich in der vermeintlichen Idylle bereits auf das große Fest vorbereitet ...
Die Erzählung aber beginnt früher, in den Dreißigerjahren, als die aufkeimende Liebe zweier junger Frauen mit der Machtübernahme Hitlers eine dramatische Wende erfährt. Nur ist Barbaras Kindern diese Vergangenheit ihrer Familie noch verschlossener als das Rätsel um ihre verschiedenen Väter. Erst ein merkwürdig erscheinender Nachbar und sein Sohn bringen Licht in dieses Dunkel, das ein Schicksal von blendender Intensität birgt.
Wir publizieren den Anfang des Romans.
**
1930: Anna
(Anna, 15)
Ach, Judith, wenn der Himmel, genau dieser Himmel, doch immer unser Zudeck sein könnte; und dieses Licht unser täglicher Morgengruß, dachte Anna.
Du,
Hut,
Jud,
schrieb sie dann. Sie saß im Gras, spürte Judiths Wade an ihrer, nutzte die Oberschenkel als Unterlage und schützte die halbe Leerseite, die sie übermütig aus ihrem Lieblingsbuch gerissen hatte und die ihr nun als Zettel diente, mit dem Handrücken vor den Blicken der Freundin.
An,
na,
schrieb Judith, dann skizzierte sie mit wenigen Strichen eine Blume.
Ansehen.
Nicken.
Zettel tauschen.
Lesen.
Grinsen.
»Ein Wort mehr, ich habe gewonnen.«
»Natürlich, dein Name gibt noch weniger Worte her als meiner. Dafür lese ich dich viel lieber rückwärts als mich, du, du schlichtes Mädchen im Alltagskleid.«
Anna nahm zwei Äpfel aus ihrem Korb, eine weiße Serviette und ein Messer. »Womit fangen wir an?«
»Das …«, ohne zu registrieren, wie Anna mehrmals sanft über die Skizze strich, als fürchtete sie, die Blume zum Welken zu bringen, wies Judith auf deren Zettel, »… war ja erst die Ouvertüre.« Dann ließ sie ihre Fingerkuppen über die sonnenwarme Haut der Freundin tanzen. »Zuerst das Ritual, dann der Apfel. Wir sind ja nicht im Garten Eden. Außerdem muss die Klinge sauber sein, sonst riskieren wir eine Blutvergiftung.« Judith nahm das Messer, blies über die Klinge, wischte sie an der noch blütenweißen Stoffserviette ab und hielt der Freundin die Innenseite ihres Arms entgegen. »Du zuerst!«
Anna schluckte, schüttelte den Kopf, weigerte sich, das Messer anzunehmen, krempelte den rechten Ärmel ihrer Bluse hoch. »Nein, du, erst du!«
Judith zuckte mit den Schultern.
Und wenn eine von uns verblutet? Der Gedanke war lächerlich, aber er ließ Anna nicht los, sie konnte kein Blut sehen, fühlte schon jetzt den Schmerz. Kein Mensch dieser Welt außer Judith dürfte ihr jemals mit dem Messer nahe kommen. Sie spürte den warmen, frischen Atem der Freundin, sah lange, dichte, geschwungene Wimpern, wusste, dass die Augen unter diesen Wimpern nach der bestmöglichen Stelle zum tiefen Schnitt spähten. Werden sie mich jemals kitzeln, diese Wimpern? Am Hals, im Nacken? Sie sah, wie sich Judiths Nasenflügel blähten, der Mund sich leicht öffnete, bevor – ein vorletzter Moment der Konzentration – die Zunge hervorspitzte, wieder verschwand.
Kalt spürte Anna die Klinge am Oberarm, dann einen Stich und ein Brennen, das sich in Sekundenschnelle ausbreitete, und »Aah« entfuhr ihr der Laut, den kein Mensch auf dieser Welt außer Judith ihr jemals würde entlocken können.
Sie schloss die Augen und ließ sich auf die Wiese zurückfallen.
»Aah? Du bist doch von allen guten Geistern verlassen!«, drang Judiths süße Stimme an ihr Ohr. »Ich bin jetzt dran, mach schon!«
Anna öffnete die Augen: Ein roter präziser Schnitt teilte ihren Oberarm in zwei Flächen, die eine weiß, die andere verzierte ein rotes Rinnsal.
»Anna, mach schon!«, drängte Judith und drückte der Freundin das Messer in die Hand.
Doch Anna zitterte nur, in ihrem Mund breitete sich ein Geschmack aus, der dem von Blut nahekam, und in ihren Ohren schwoll ein Rauschen an. Sie griff nach Judiths ausgestrecktem Arm, doch sie hatte nicht einmal die Kraft, das Handgelenk fest zu umschließen.
Judith entriss ihr das Messer, ehe es ihr aus der Hand fallen konnte. Ohne den besorgten Blick von Anna abzuwenden, ritzte sie sich in den Arm, an exakt der gleichen Stelle, ein Schnitt von exakt der gleichen Länge, und schon warf sie das blutige Messer unachtsam ins Moos.
Schon spürte Anna die Kräfte zurückkehren, schon näherten sich die beiden einander, wurde Schnitt auf Schnitt, Wunde auf Wunde, Arm auf Arm gepresst, nicht eine Sekunde, nicht zwei Sekunden, nein drei, vier, fünf schmerzhaft verschworene Sekunden, eine euphorische Ewigkeit.
Schon richtete Judith sich auf, griff erneut zum Messer, nahm die wenigen Schritte über waldiges Moos zur nächsten Birke, die, jung noch, aber rindenreich, nur auf die Begegnung mit den beiden Mädchen gewartet zu haben schien.
Schon ritzte Judith Rinde so rigoros wie zuvor Haut: »Das Häuten habe ich mir für den Baum aufgespart.«
Lachend kehrte sie mit zwei Rindenstreifen zurück und lachend bettete sie ihren Kopf auf den Bauch ihrer Freundin, die ihr ein Rindenpflaster verpasste, ehe Judith sie ebenfalls verarztete. Dann verstummten sie, sahen entlang der schwarz-weiß-grauen Stämme durch hellgrüne Blätter ins Blau des Nachmittages.
Judith vernahm ein Zwitschern in weiter Ferne: »Ein Zeisig!«
Anna vernahm ein Pochen ganz nah. Ein Herz!
Judith verabschiedete sich vom Himmel, ein wenig zu schnell vielleicht für Annas Gefühl, und widmete sich erneut den Schnitten, den Wunden, den Rinden: »Was für ein Irrsinn!«, erzählte sie dem Zeisig. »Ist dir klar, dass wir gerade ein germanisches Ritual vollzogen haben?«
»Wieso germanisch?«, Anna schob den Kopf ihrer Freundin zur Seite, um nach ihrem Lieblingsbuch zu greifen: »Seit wann sind die Mescalero-Apachen germanisch?«
»Das fragst du am besten deinen Karl May.« Judith sprang ohne Vorwarnung in die Hocke, ließ sich auf die liegende Anna fallen und presste ihr, nicht auf die Wunde, sondern auf die Stirn, keine Rinde, sondern einen Kuss. Einen Blutsschwesternkuss?
2013: Vorabend des Festes
(Erwartung)
»Natürlich wollte ich. Aber ich kann den Termin nicht wahrnehmen.«
»Du sollst keinen Termin wahrnehmen, sondern deine Mutter vom Flughafen abholen.«
»Mach mir bitte kein schlechtes Gewissen. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, und die Kinder haben alle einen Führerschein. Drück einem von ihnen einen Autoschlüssel in die Hand, und sie werden sich streiten, wer einen Ausflug zum Flughafen machen darf.«
»Darum geht es doch nicht! Natürlich wird irgendjemand Zeit haben.«
»Nicht irgendjemand; das sind Menschen, die ihr nahestehen. Egal, wer sie abholt, sie wird sich freuen.«
Abholen wird, verbessert Miriam ihren Bruder Michael in Gedanken, oder eben nicht abholen wird. »Sie wird enttäuscht sein. Die Sache mit dem Familientreffen hat sie mir auch nicht wirklich abgekauft. Dass wir das Bedürfnis nach gemeinsamem Urlaub haben! Sie erwartet ihren ältesten Sohn am Flughafen. Und niemand anderen.«
»Dann wird es für sie eben eine vorzeitige Geburtstagsüberraschung geben: Natalie, Ben, Valentina … Paul, wer auch immer.«
»Michael, ich kenne meine Familie.«
»Und die Psyche unserer Mutter kennt auch keiner besser als du.«
»Gut genug zumindest, um zu wissen, auf welche Art von Überraschungen sie verzichten kann. Und dass sie nicht unbedingt flexibler geworden ist im Alter.«
»Sagst du.«
»Sage ich.«
»Dann sehen wir uns morgen Abend am Ammersee, Miriam, mit Mutter und allen anderen. Ich muss hier weitermachen.«
»Es kann doch verdammt noch mal nicht so ein Problem sein, eure Großmutter vom Flughafen abzuholen.«
Miriam ärgert sich, dass sie Freiwillige rekrutieren muss, dass sie es ist, die dieses Gespräch führen muss, hier beim Abendessen unter dem großen Walnussbaum – eigentlich ganz so, wie sie es sich immer ausgemalt hat, eine lange Tafel mit weißer Tischdecke, um sie herum die ganze Großfamilie, endlich dort angekommen, wo ihre Mutter aufgewachsen ist.
»Irgendjemand wird sie schon abholen«, flüstert Werner, ihr Mann, und greift nach ihrer Hand, obwohl er weiß, dass sie beide Hände zum Gestikulieren braucht.
»Jeder, der hier sitzt, hat Urlaub, und es spricht nichts dagegen, einen Bruchteil dieses Urlaubs damit zu verbringen, die Frau, die einen geboren und großgezogen hat, vom Flughafen abzuholen«, verkündet sie nun so laut, dass es auch Paul am anderen Ende der Tafel hören kann.
Ihr Neffe Paul, dessen gesamtes Leben eine Entdeckungsreise zu sein scheint und der schon seit Minuten damit beschäftigt ist, die Abendsonne in seinem Fischmesser einzufangen und damit Lichtflecken auf die Gesichter seiner Cousins und Cousinen zu projizieren.
Natalie neben ihr kichert, doch das nimmt sie ihrer jüngsten Nichte nicht übel: Natalie ist gerade fünfzehn geworden – und seit drei Jahren kann sie nichts als kichern, jammern oder heulen, wie Miriam sich regelmäßig von ihrer Schwester in langen, genervten E-Mails aus Paris berichten lassen muss.
»Mich hat sie nicht geboren«, hört sie Natalie sagen.
Trotzdem weißt auch du nicht, wer dein Vater ist, denkt Miriam. Aus dem Augenwinkel sieht sie den Nachbarn, der sich mit einem großformatigen Buch im Schoß, versteckt hinter seiner Sonnenbrille, jenseits des Gartenzauns im Liegestuhl fläzt.
»Danke für die Vermittlung, wir machen uns morgen bekannt«, nickt und ruft sie ihm zu, dann wendet sie sich wieder an ihre Familie. »Irgendjemand muss sie abholen.«
Den Nachbarn könnte man eigentlich auch einladen …
»Irgendjemand wird morgen seine Mutter, Großmutter oder Schwiegermutter vom Flughafen abholen.«
Doch wieso noch Fremde einladen, wenn schon die eigene Familie größte Probleme bereitet?
»Ich will das geklärt haben, bevor wir anfangen zu essen.«
Miriam entgeht nicht, wie der Nachbar im Schutz von Buch und Brille und im Rhythmus ihrer Forderungen mehrfach nickt, wie Paul mit seiner Schwester Valentina tuschelt.
Valentina, die mit fünfzehn noch mit Puppen gespielt hat – das wurde ihr zumindest kolportiert. Ein argloses Wesen, das mit Miriams Pflichtbewusstsein und Aktionismus nicht das Geringste anfangen kann. Doch das Lächeln, das Valentina ihr jetzt zuwirft, ist kein verständnisloses, auch kein vorwurfsvolles, kein überhebliches und auch kein genervtes. Es ist eher verschwörerisch, und bevor Miriam sich eingestehen kann, wie gut dieses Lächeln tut, zwinkert ihr auch noch Paul zu. So, wie man keinem Menschen zuzwinkert, den man nicht mag.
»Tante Miriam, wie wärʼs, wenn wir zur Abwechslung mal dich ausfragen? Immerhin bist du ihre Lieblingstochter. Dir müsste es Oma doch erzählt haben. Kann es sein, dass … dieses Haus … spricht?«
»Spricht?«, fragt Miriam.
Dann hätte es unserer Familie eine Menge voraus, würde sie gern erwidern, doch es tut zu gut, angelächelt zu werden, im Schein der Abendsonne, unter diesem gigantisch großen Nussbaum, und auch die Neugier in den Augen ihres Neffen, die Vorfreude in den Augen ihrer Nichte tun gut.
»Spricht? Wie kommt ihr denn darauf?«
»Spricht, flüstert, lebt. Irgendeinen Grund muss es doch geben, dass Oma dieses Wahnsinnshaus verkauft hat«, sagt Paul.
»Sie hat das Nachbarhaus verkauft. Dieses Haus hat ihr nie gehört«, antwortet Miriam, was ganz offensichtlich nicht die gefragte Information zum Thema ist.
»Ihr seid ja erst heute angekommen«, wendet sich Valentina nun an die Runde. »Die Einzigen, die hier schon eine Nacht verbracht haben, sind Tante Miriam, Onkel Werner und ich. Und es hat nicht nur geknarzt. Ein leises Klopfen war zu hören, und immer wieder so was wie Seufzen. War es in eurem Zimmer denn ruhig, Tante Miriam?«
»Natürlich nicht.« Jetzt ist es Miriam, die lächelt. Erst Richtung Paul und Valentina, dann ihrem Mann direkt ins Gesicht. »Falls es irgendwelche Geister in diesem Haus geben sollte, sind wir vor ihnen sicher. Zumindest solange Werner hier ist und sie mit seinem Schnarchen vertreibt.«
»Geister!«, ruft Angelika jetzt über die Länge des Tisches und zwinkert ihrem Mann Ben zu.
»Geister sind immun gegen Schnarchen, manche lassen sich sogar nur durch Schnarchen anlocken«, sagt der.
Miriam würde gerne gähnen und nach diesem heißen, drückenden Tag einfach nur die letzten Strahlen der Abendsonne genießen, würde gerne schweigend in den Walnussbaum schauen, die zu engen Sandalen ausziehen und die nackten Zehen in den moosigen Boden unterm Esstisch drücken. Würde. Konjunktiv.