Logen-Blog [261]: Der Blogger überspringt die Dichtungstheorie
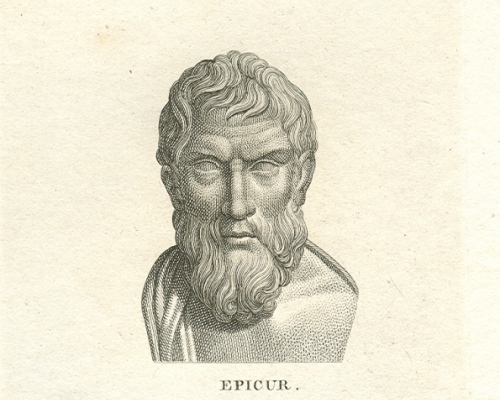
Wir übergehen Jean Pauls Dichtungstheorie, die er in seine poetischen Blütenblätter gelegt hat – derzufolge die Romanautoren sich die „Zeichnungen von Menschen aus der Luft holen, wo alle epikurische Abblätterungen wirklicher Dinge fliegen“. Genau: Epikur meinte, dass die Welt aus herumfliegenden Atomen bestünde, die sich immer wieder zu neuen Erscheinungen materialisieren. Die Atome segeln durch den Raum, weichen immer wieder von einer idealen Senkrechten ab und gruppieren sich derart neu, dass immer wieder neues Leben entsteht.
Ohne allzu sehr in die Tiefe (oder Höhe) zu gehen: dass jegliches Leben Energie ist, das im Tode bzw. in der äußerlichen Vernichtung nicht verfliegen, sondern sich nur verwandeln kann, um vielleicht irgendwann in neuen Erscheinungen zum Körper zu werden – meinethalben zum Körper eines feinmateriellen Gespensts –, diese These wird, glaube ich, nach wie vor diskutiert, auch wenn man in esoterischen Kreise das wissenschaftliche Wort Atom eher selten in den Mund nimmt. Epikur, beim allgemeinen Publikum eher bekannt für seine oft missverstandene, aber maßvolle wie humane Lebensphilosophie, hat immerhin versucht, aus einer atomistischen Weltsicht (ich möchte das so unscharf nennen) ein rationales Erklärungsmodell für die Entstehung der Welt, nein: der Welten zu gewinnen. Die moderne Kosmologie und die Entdeckung allerwinzigster, für die „Erschaffung“ der Welt(en) entscheidender Teilchen, für die zwei Wissenschaftlern vor kurzem der Nobelpreis verliehen wurde, hat noch mit diesen Teilchenfragen zu tun. Jean Paul bezieht sich auf diese Diskussion, um aus ihr hübsches, rotes satirisches Gold zu schlagen; er tut es als Epikuräer, der sich lustvoll in die Gefilde der literarischen Erkenntnis- und Vergleichungsfreuden begibt: ein Autor, der die Atome der Ideen neu zusammensetzt um damit seinerseits seinen mit Abblätterungen wirklicher Dinge reich versehenen Roman zu schaffen und zu schöpfen.
Im Übrigen war er, soweit es die rein körperlichen Bedürfnisse betrifft (aber Körper und Seele sind für einen Epikurärer nicht zu trennen; damit tut er Recht), ein lupenreiner Epikuräer – wenn er nicht gerade, was gelegentlich geschah, zu tief ins Bierglas schaute. Auf dem Jean-Paul-Weg haben wir – sinnigerweise in der Bayreuther Altstadt, also in bewusster Nähe des Becher-Bräu, in dem das köstliche Jean-Paul-Bier gebraut wird – eine Großtafel mit ![]() Texten zum Thema „Essen und Trinken“ untergebracht. Quintessenz des Ganzen: Jean Paul war, im reinen epikuräischen (oder epikurischen, wie er korrekt sagt) Sinne, ein Genießer, d.h.: er genoss das, was ihm zur Verfügung stand, ganz im Sinne des großen, nach wie vor aktuellen Denkers, des ersten Epikurers Epikur:
Texten zum Thema „Essen und Trinken“ untergebracht. Quintessenz des Ganzen: Jean Paul war, im reinen epikuräischen (oder epikurischen, wie er korrekt sagt) Sinne, ein Genießer, d.h.: er genoss das, was ihm zur Verfügung stand, ganz im Sinne des großen, nach wie vor aktuellen Denkers, des ersten Epikurers Epikur:
Nichts ist dem genug, dem das Genügende zu wenig ist.
Jede Lust ist ein Gut, weil sie uns vertrauter Natur ist, doch sollte nicht jede gewählt werden...
Diese beiden Sätze könnten von Jean Paul erfunden worden sein. Er hätte sie gewonnen aus den Erfahrungen seiner ärmlichen Kindheit, seiner armen Leipziger Studentenexistenz und einem unfassbar starken intellektuellen Ego, das ihn die Armut überwinden hieß, indem er den Geist, nicht den Bauch an die erste Stelle setzte. Diese Lebenshaltung hat nichts – oder doch nur ein wenig – mit dem problematischen wie kritisierbaren „Idealismus“ zu tun. Sie ist jedoch eine Haltung der Vernunft, die auf die Freuden des Bauchs durchaus nicht verzichtet, sondern – im Maß – sogar noch zu steigern weiß. Maßhalten: es bedeutet nicht, die Welt zu unterschätzen, sondern in jedem einzelnen Atom zu schätzen und zu lieben und mit allen nur möglichen, gelegentlich atomkleinen Details abzubilden – und vielleicht sogar, Epikur hätte auch dies unterschrieben, das zu schätzen und anzunehmen und vor allem im Wort festzuhalten, was nicht „gut“, sondern „schlecht“ genannt werden muss. Damit wären wir schon fast beim Jubilar des nächsten Monats angekommen: bei Albert Camus, der seine Philosophie des „guten Lebens“ aus der mittelmeerisch geprägten Anerkennung des Lebens an sich gewann – aber ich möchte nicht vorgreifen.
Vorderhand bleibt es übrig zu sagen, dass ich Jean Pauls Dichtungstheorie lieber übergehe und schnell weitereile.
Logen-Blog [261]: Der Blogger überspringt die Dichtungstheorie
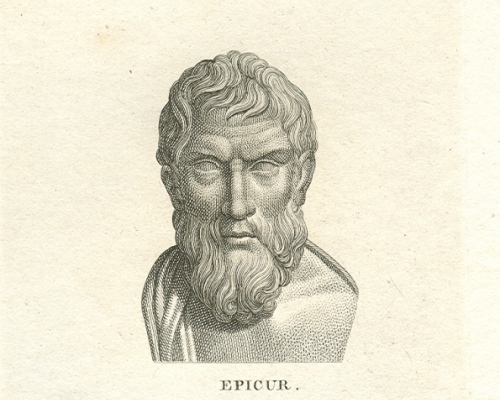
Wir übergehen Jean Pauls Dichtungstheorie, die er in seine poetischen Blütenblätter gelegt hat – derzufolge die Romanautoren sich die „Zeichnungen von Menschen aus der Luft holen, wo alle epikurische Abblätterungen wirklicher Dinge fliegen“. Genau: Epikur meinte, dass die Welt aus herumfliegenden Atomen bestünde, die sich immer wieder zu neuen Erscheinungen materialisieren. Die Atome segeln durch den Raum, weichen immer wieder von einer idealen Senkrechten ab und gruppieren sich derart neu, dass immer wieder neues Leben entsteht.
Ohne allzu sehr in die Tiefe (oder Höhe) zu gehen: dass jegliches Leben Energie ist, das im Tode bzw. in der äußerlichen Vernichtung nicht verfliegen, sondern sich nur verwandeln kann, um vielleicht irgendwann in neuen Erscheinungen zum Körper zu werden – meinethalben zum Körper eines feinmateriellen Gespensts –, diese These wird, glaube ich, nach wie vor diskutiert, auch wenn man in esoterischen Kreise das wissenschaftliche Wort Atom eher selten in den Mund nimmt. Epikur, beim allgemeinen Publikum eher bekannt für seine oft missverstandene, aber maßvolle wie humane Lebensphilosophie, hat immerhin versucht, aus einer atomistischen Weltsicht (ich möchte das so unscharf nennen) ein rationales Erklärungsmodell für die Entstehung der Welt, nein: der Welten zu gewinnen. Die moderne Kosmologie und die Entdeckung allerwinzigster, für die „Erschaffung“ der Welt(en) entscheidender Teilchen, für die zwei Wissenschaftlern vor kurzem der Nobelpreis verliehen wurde, hat noch mit diesen Teilchenfragen zu tun. Jean Paul bezieht sich auf diese Diskussion, um aus ihr hübsches, rotes satirisches Gold zu schlagen; er tut es als Epikuräer, der sich lustvoll in die Gefilde der literarischen Erkenntnis- und Vergleichungsfreuden begibt: ein Autor, der die Atome der Ideen neu zusammensetzt um damit seinerseits seinen mit Abblätterungen wirklicher Dinge reich versehenen Roman zu schaffen und zu schöpfen.
Im Übrigen war er, soweit es die rein körperlichen Bedürfnisse betrifft (aber Körper und Seele sind für einen Epikurärer nicht zu trennen; damit tut er Recht), ein lupenreiner Epikuräer – wenn er nicht gerade, was gelegentlich geschah, zu tief ins Bierglas schaute. Auf dem Jean-Paul-Weg haben wir – sinnigerweise in der Bayreuther Altstadt, also in bewusster Nähe des Becher-Bräu, in dem das köstliche Jean-Paul-Bier gebraut wird – eine Großtafel mit ![]() Texten zum Thema „Essen und Trinken“ untergebracht. Quintessenz des Ganzen: Jean Paul war, im reinen epikuräischen (oder epikurischen, wie er korrekt sagt) Sinne, ein Genießer, d.h.: er genoss das, was ihm zur Verfügung stand, ganz im Sinne des großen, nach wie vor aktuellen Denkers, des ersten Epikurers Epikur:
Texten zum Thema „Essen und Trinken“ untergebracht. Quintessenz des Ganzen: Jean Paul war, im reinen epikuräischen (oder epikurischen, wie er korrekt sagt) Sinne, ein Genießer, d.h.: er genoss das, was ihm zur Verfügung stand, ganz im Sinne des großen, nach wie vor aktuellen Denkers, des ersten Epikurers Epikur:
Nichts ist dem genug, dem das Genügende zu wenig ist.
Jede Lust ist ein Gut, weil sie uns vertrauter Natur ist, doch sollte nicht jede gewählt werden...
Diese beiden Sätze könnten von Jean Paul erfunden worden sein. Er hätte sie gewonnen aus den Erfahrungen seiner ärmlichen Kindheit, seiner armen Leipziger Studentenexistenz und einem unfassbar starken intellektuellen Ego, das ihn die Armut überwinden hieß, indem er den Geist, nicht den Bauch an die erste Stelle setzte. Diese Lebenshaltung hat nichts – oder doch nur ein wenig – mit dem problematischen wie kritisierbaren „Idealismus“ zu tun. Sie ist jedoch eine Haltung der Vernunft, die auf die Freuden des Bauchs durchaus nicht verzichtet, sondern – im Maß – sogar noch zu steigern weiß. Maßhalten: es bedeutet nicht, die Welt zu unterschätzen, sondern in jedem einzelnen Atom zu schätzen und zu lieben und mit allen nur möglichen, gelegentlich atomkleinen Details abzubilden – und vielleicht sogar, Epikur hätte auch dies unterschrieben, das zu schätzen und anzunehmen und vor allem im Wort festzuhalten, was nicht „gut“, sondern „schlecht“ genannt werden muss. Damit wären wir schon fast beim Jubilar des nächsten Monats angekommen: bei Albert Camus, der seine Philosophie des „guten Lebens“ aus der mittelmeerisch geprägten Anerkennung des Lebens an sich gewann – aber ich möchte nicht vorgreifen.
Vorderhand bleibt es übrig zu sagen, dass ich Jean Pauls Dichtungstheorie lieber übergehe und schnell weitereile.

